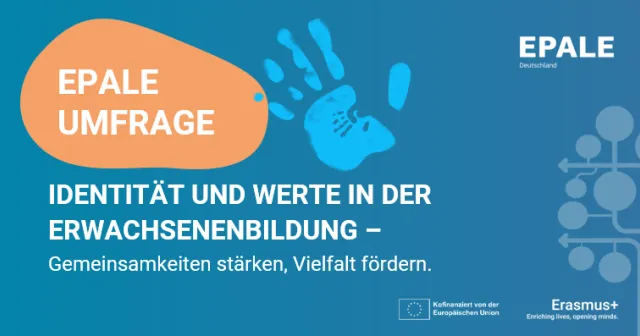Um Aktivität zu fördern, muss man Passivität verstehen
Es ist recht frustrierend, wenn sich nach vielen Stunden Arbeit, nach vielen Emotionen, investierter Zeit und ausgegebenen Mitteln herausstellt, dass unsere kulturellen, sozialen und Bildungs-Angebote auf wenig Interesse bei den Empfängern stoßen und die Resonanz auf zahlreiche Einladungen schwach ist. In einem solchen Fall kommt es vor, dass man sich über die Passivität von Erwachsenen beschwert. Die Angebote sind schließlich vielfältig, interessant und professionell . Nur fehlt es manchmal an Interessierten.
Um die Aktivität der Erwachsenen zu fördern, lohnt es sich, die Wirkungsweisen und verschiedenen Formen von Passivität kennenzulernen. Aktiv zu sein ist etwas Natürliches. Dieses Verhalten resultiert aus persönlichen Interessen, Bedürfnissen und Ansprüchen. Passivität steht für Rückzug, Resignation und Stagnation. Es gibt jedoch Situationen, in denen es sich für Erwachsene mehr „lohnt“, nicht aktiv zu werden, statt Mühen oder gar Risiken auf sich zu nehmen. Nicht jeder assoziiert Ausgehen und alleine oder in einer Gruppe aktiv sein mit etwas Positivem. In diesem Beitrag möchte ich ein paar Formen der Passivität anführen, die hilfreich sein können, wenn man die fehlende oder eingeschränkte Aktivität von Erwachsenen interpretieren möchte.

Von Passivität aufgrund von Überdruss spricht man, wenn wir mit einem Überangebot konfrontiert werden. Manchmal kommt es vor, dass lokale Institutionen/Stakeholder so viele Veranstaltungen, Projekte oder Workshops anbieten, dass die Zielgruppe verdrossen wird. Hyperaktivität bewirkt, dass man keine Zeit zum Reflektieren, für die Freude am Ereignis oder ganz einfach zum Ausruhen hat. Das Rasen von einer Aktivität zur nächsten führt mit der Zeit dazu, dass man entschleunigen, Abstand nehmen und sich ausruhen möchte. Gibt es Zeiten der Aktivität, so muss es im Anschluss auch Raum zum „Nichtstun“, zum Verarbeiten von Eindrücken, Erfahrungen und Emotionen geben. Passivität aufgrund von Überdruss lässt sich häufig bei Schulungen beobachten. Manche Berufsgruppen sind „übermäßig gebildet“, weil ihnen ständig die Erweiterung ihrer Qualifikationen und Kompetenzen abverlangt wird. Irgendwann machen selbst die professionellsten und attraktivsten Bildungsangebote keinen Spaß mehr. Zu viele Angebote können die Wahl für eines erschweren. Es ist nicht einfach einzuschätzen, welches Angebot wirklich attraktiv und nützlich ist, wenn man zu viele Optionen berücksichtigen muss.
Die Passivität extern gesteuerter Menschen. Ein extern gesteuerter Mensch ist von der Umgebung, anderen Menschen, Institutionen oder Organisationen, abhängig. Wichtig ist dabei auch, dass sein Verhalten durch Belohnung und Strafe „gesteuert“ wird. Er wird nur dann aktiv, wenn ihn jemand dazu anspornt. Dabei ist es unerheblich, ob dies mit Zuckerbrot oder Peitsche geschieht. Wichtig ist nur, dass es sich dabei um einen externen Antrieb handelt. Extern gesteuerte Menschen werden nicht aus eigenem Antrieb aktiv. Jemand muss sie ermutigen und ihnen die Vor- und Nachteile von Untätigkeit aufzeigen.
Passivität als Folge von Sozialisation. Passives und unterwürfiges Verhalten kann erlernt sein. Diese Schule durchlaufen wir im Rahmen der Sozialisation oder Erziehung. Manchmal sind die Botschaften sehr direkt: Das ist nichts für dich. Lehn‘ dich nicht zu sehr aus dem Fenster. Dräng‘ dich nicht vor. Sei lieber still... Manchmal betrifft das Erlernte konkrete Orte oder Situationen: den Theater-, Bibliotheks- und Opernbesuch, die Teilnahme an Workshops und anderen Aktivitätsformen. Daraufhin hört man folgendes: Das ist nichts für mich. Ich fühle mich an solchen Orten unwohl. Das Niveau ist zu hoch... Ein Gegenmittel gegen solche, manchmal jahrelang gefestigte, Überzeugungen sind neue, positive Erfahrungen. Die Schwierigkeit besteht darin, solche Personen zum ersten Schritt zu bewegen...
Passivität als Charakterzug. Bei einigen Menschen können die Passivität, das Nichtergreifen der Initiative und Inaktivität eine Charakterzug sein. Es kann sich dabei um eine individuelle „Lebensphilosophie“ handeln, aber es gibt auch Gruppen, in denen Verhaltensweisen wie Konformismus, Unterwürfigkeit und Gehorsam als wertvolle Charakterzüge wahrgenommen, belohnt und gestärkt werden. In einem solchen Fall wird man nur dann aktiv, wenn man dazu eingeladen, aufgefordert oder ermutigt wird. Menschen, die Passivität und Selbstbeschränkung als wertvollen Charakterzug erachten, werden nicht aus eigener Initiative aktiv. Gerade solche Gruppen fordern häufig, in Ruhe gelassen zu werden.
Passivität als Folge erlernter Ratlosigkeit. Hierbei handelt es sich um einen bekannten Mechanismus, der von Martin Seligman beschrieben worden ist. Wenn jemand erlebt, dass seine bisheriges Handeln keinen positiven Effekt hat oder – schlimmer noch – die Situation verschlimmert, hat er keinen Grund, um weiterzumachen oder nach neuen Lösungen zu suchen. Eine solche Haltung kann auch auf der Überzeugung beruhen, dass man keinen Einfluss auf die jeweilige Situation hat beziehungsweise diese nicht kontrollieren kann. Eine wichtige Rolle beim Entstehen dieser Art der Passivität spielen Erfahrungen.
Es handelt sich nicht um einen geschlossenen Katalog möglicher Passivitätsarten. Alle an diesem Phänomen Interessierten möchte ich auf den sehr inspirierenden Text von Wojciech Poznański mit dem Titel „O niektórych przyczynach i mechanizmach bierności społecznej“ („Über manche Gründe und Mechanismen der sozialen Passivität“)[1] verweisen. Das Verständnis der Mechanismen hinter dem Verzicht auf Aktivität kann eine gute Grundlage für die Vorbereitung integrativer Projekte darstellen. Eine zutreffende Diagnose erhöht immer die Treffsicherheit der geplanten Angebote. Das Verständnis für Passivität bietet auch den angemessenen Abstand, um den Erfolg oder Misserfolg unserer Vorhaben einschätzen zu können. Nicht alles hängt von uns ab. Manchmal wollen oder können sich Menschen einfach nicht engagieren.
[1] W. Poznaniak (1999). O niektórych przyczynach i mechanizmach bierności społecznej. In: H. Sęk und S. Kowalik (Hg.), Psychologiczne konteksty problemów społecznych. Poznań: Humaniora.
***
Dr. habil. Małgorzata Rosalska – Pädagogin, Berufsberaterin, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts für Lebenslanges Lernen und Berufsberatung an der Fakultät für Bildungsstudien der Adam-Mickiewicz-Universität Poznań. Sie ist spezialisiert in den Themen Bildungs- und Berufsberatung, Arbeitsmarktpolitik, Erwachsenenbildung und Bildungspolitik. Sie ist EPALE-Botschafterin.