Erzähl deine Geschichte: Gefährdete Erwachsene durch Digitales Storytelling befähigen
Lesedauer circa sieben Minuten - Lesen, liken und kommentieren!
Originalsprache: Englisch

Wir alle haben Geschichten zu erzählen, aber nicht alle diese Geschichten werden auch gehört. Aleksandra Kozyra vom EAEA hat sich mit zwei Pädagogen unterhalten, die mithilfe audiovisueller Methoden gefährdete Gruppen dazu motivieren, ihre Erfahrungen zu teilen und Gehör zu finden.
„Unsere Lernenden sind Menschen, die einander nicht kennen und keinerlei Erfahrung mit dem Drehen von Videos haben. Aber sie alle haben das Gefühl, kein Gehör zu finden, oder tun sich schwer mit Gruppenarbeit“ – das erzählt mir Łukasz Szewczyk, der sich in seiner Arbeit mit Partizipativer Videoproduktion und Digitalem Storytelling befasst.
Unser Gespräch findet in Helsinki statt, wo der EAEA an einem Partner-Treffen im Rahmen von Education by the Way [EN] teilnimmt – einem Erasmus+-Projekt, bei dem verschiedene Methoden für die Arbeit mit gefährdeten Erwachsenen analysiert werden. Storytelling, einschließlich Digitales Storytelling, ist eine der Methoden, über die wir uns mit den Erwachsenenbildner*innen unterhalten haben, die ihre eigenen Erfahrungen und Tools einbringen durften. Wie Łukasz erläutert, bringt diese Methode für bestimmte Zielgruppen enorme Vorteile mit sich.
„Bei Cotopaxi arbeiten wir mit den verschiedensten Zielgruppen, die unterrepräsentiert sind und nicht immer Gehör finden: Lernenden mit körperlichen oder geistigen Behinderungen, Menschen, die eine psychische Krise hinter sich haben oder an einer psychischen Erkrankung leiden, Seniorinnen und Senioren und Jugendlichen.“
Die Beziehungen werden enger, die Menschen öffnen sich
„Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf die Vorteile, die mit der Teilnahme in einer Gruppe verbunden sind, und auf die Entwicklung verschiedener Soft Skills. Wir bieten unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern einerseits eine Begegnungsstätte. Andererseits lernen sie mit ihrer Arbeit an einem Video auch, wie man zusammenarbeitet, seine Geschichte erzählt und anderen zuhört“, führt Łukasz aus.
Aber es gibt auch noch weitere positive Aspekte. Wie Łukasz erklärt, erweist sich Engagement als wichtiges Element bei der Erstellung eines Videos. „Eine Gruppe von Seniorinnen hat bei uns einmal ein Video darüber gedreht, wie schwierig es ist, einen Platz in einem Pflegeheim zu finden – und letztlich hat eine von ihnen daraufhin einen Platz bekommen“, freut sich Łukasz.
Łukasz berichtet, wie interessant er es findet, die Teilnehmer*innen zu begleiten und ihre Fortschritte im Laufe des Kurses zu beobachten. Besonders am Herzen liegt ihm eine Gruppe, deren Teilnehmer*innen alle aufgrund eines psychischen Zusammenbruchs nicht mehr arbeiten können.
„Als ich zum ersten Mal mit dieser Gruppe gearbeitet habe, waren alle noch sehr zurückhaltend und fühlten sich bei uns und auch untereinander nicht sicher. Nach und nach haben wir dann die jeweiligen Geschichten voneinander erfahren. So hat beispielsweise ein Teilnehmer ein Video gedreht, in dem er seine Psychose und die damit verbundenen Krisen beschreibt und seine Sicht der Dinge erzählt. Dies ist ein unvorstellbares Zeichen des Vertrauens in sich selbst, in uns und die Gruppe.
Digitales Storytelling befähigt
Da ich noch mehr über die Methoden erfahren wollte, habe ich mich an eine weitere Organisation gewandt, die gefährdete Erwachsene in Workshops durch Digitales Storytelling stärkt.
„Digitales Storytelling läuft mehrschichtig ab: Es kann traumatisierte Menschen in die Lage versetzen, dieses Trauma zu beschreiben und zu überwinden, es aus einer anderen Perspektive zu betrachten“, erzählt mir Jasper Pollet von Maks.
Maks [EN] ist eine gemeinnützige Organisation in Brüssel, bei der man in Kursen von grundlegenden Computerkenntnissen bis hin zum Coden die unterschiedlichsten Kompetenzen erwerben kann. Maks hat ihren Sitz in der Nähe von Kuregem und Molenbeek, den in den Medien oft als „berüchtigt“ bezeichneten Vierteln mit einem großen Anteil an Migrant*innen. Die Organisation hilft gefährdeten Jugendlichen und Erwachsenen dabei, sich in einer Diskussion, in der ihnen offenbar kein Raum gegeben wird, Gehör zu verschaffen.
„Digitales Storytelling kann die Menschen wirklich stärken. Unmittelbar nach den Terroranschlägen in Paris und Brüssel fühlten sich viele junge Menschen von der gesamten Community beobachtet, weil sie einen Migrationshintergrund hatten“, so Jasper. „Sie hatten dazu eine eigene Meinung und waren mit der aktuellen Diskussion nicht einverstanden, an der ihnen sehr viel lag. Wir sind dort in die Schulen gegangen und haben die Schülerinnen und Schüler zu ihrer Meinung befragt.“
Jasper erzählt noch von einem weiterem Beispiel: einem Projekt über die Geschichten von Frauen, die Opfer von Gewalt geworden waren. „Ich selbst war an diesem Projekt nicht beteiligt“, betont er. „Was so großartig an diesem Projekt war, dass es von Frauen für Frauen war. Dabei ist eine sehr starke Gruppe entstanden, die durch ihre persönlichen Geschichten eng zusammengewachsen sind.“
„Das Thema war eher weit gefasst: Manche Frauen waren vor einem Krieg geflohen, andere hatten häusliche Gewalt erfahren und ihre Erfahrungen waren in den eigenen vier Wänden verborgen. Obwohl sie über sehr unterschiedliche Hintergründe verfügten, hatten sie alle traumatische Erfahrungen gemacht, die sie zusammengeschweißt haben.“
Ich persönlich frage mich hier: Gibt es angesichts so schwieriger Themen nicht Momente, in denen die Teilnehmer*innen aussteigen wollen? Hier betont Jasper die Schlüsselrolle, die die Ausbilder*innen und Workshop-Leiter*innen dabei spielen, damit alle sich sicher fühlen:
„Bei diesem Projekt gab es Frauen, die aus nachvollziehbaren Gründen schüchtern waren und nur ungern über ihre Erfahrungen sprechen wollten. Aber unsere Workshop-Leiter*innen konnten ihnen sehr gut helfen“, führt Jasper aus und merkt an, dass die Grenzen von Anfang an klar sein müssen. „Wir schaffen einen sicheren Raum. Wir stellen auch gleich zu Beginn klar, dass eines unserer Ziele darin besteht, die Videos auch zu zeigen, wobei wir bei gewissen Dingen auch flexibel sein können, wenn es den Teilnehmerinnen unangenehm wird.“
Zeigen oder nicht zeigen?
Jasper macht deutlich, wie wichtig es ist, das gesamte Projekt mit einer öffentlichen Vorführung der Videos zu beenden. „Man hört die Geschichten und das Endergebnis ist beeindruckend und schließt das gesamte Projekt ab.“
Das soeben beschriebene Projekt ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Es endete mit einer großen Vorführung: Manche Frauen hatten ihre Videos komplett anonym gedreht, andere wiederum waren viel offener.
„Die Frauen haben Verwandte, Freundinnen und Freunde eingeladen, die keine Ahnung hatten, was passiert war. Das war ein starker Moment. Manchen männlichen Familienmitgliedern haben wir dann die Gelegenheit gegeben, als Reaktion darauf ihre eigene Geschichte zu erzählen.“
Daraufhin wurden noch mehr Geschichten erzählt, ebenfalls in digitaler Form. „Es war unglaublich berührend“, so Jasper.
Eine Vorführung kann allerdings auch schwierig sein. Zu einigen damit verbundenen Herausforderungen äußert sich Łukasz folgendermaßen:
„Unsere Vorführungen waren immer öffentlich: Wir haben externe Gäste eingeladen und die Videos in einem Kino gezeigt. Unsere Vorführungen sind immer noch wie im Kino, aber wir haben einiges verändert.“
Jetzt ist alles etwas flexibler: Cotopaxi zeigt das Video keinem größeren Publikum mehr, wenn die Gruppe dies nicht möchte; die Vorführung ist dann nur für die Workshop-Teilnehmer*innen. Aber auch eine interne Vorführung kann schmerzliche Emotionen wecken.
„Einmal haben wir ein Video gesehen, das für die Gruppe so bewegend und schwierig war, dass wir vorgeschlagen haben, allen Zeit zu geben und es drei Monate später noch einmal zu zeigen. Letzten Endes haben wir es dann gar nicht mehr gezeigt – es war so schwer, es noch einmal zu sehen, dass wir das Vorhaben begraben haben“, erläutert Łukasz.
„Wir versuchen immer, mindestens eine Vorführung für alle Beteiligten zu organisieren. Wenn diese es dann wünschen, wird das Video auch einer größeren Gruppe gezeigt. Dann laden wir deren Freundinnen, Freunde und Verwandte ein und feiern, auch wenn wir dabei nicht unbedingt den roten Teppich ausrollen!“
Einige der entstandenen Videos können Sie hier sehen (mit englischen Untertiteln):
221
Video einer Gruppe mit psychischen Erkrankungen, gedreht als Partizipatives Video mithilfe von Cotopaxi Film Workshop Association.
Seniors about themselves
Happy Birthday
Digitale Story einer Teilnehmerin des Projekts zum Thema häusliche Gewalt.
Cruise on my tears
Digitale Story eines Häftlings über seine Erfahrungen, erzählt im Rahmen eines Projekts von Maks.
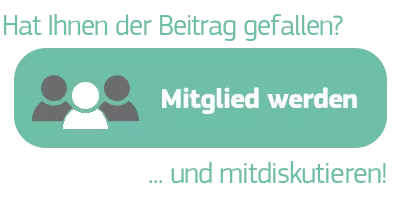


Über die Autorin: Aleksandra Kozyra ist beim Europäischen Verband für Erwachsenenbildung (EAEA) zuständig für das Mitglieder- und Veranstaltungsmanagement. Sie organisiert Konferenzen und das jährliche Younger Staff Training. Davor war sie in Polen als Sprachlehrerin in der Erwachsenenbildung tätig.




