Die sozial-ökologische Transformation
Lesedauer ca. 6 Minuten - lesen, linken, kommentieren!
Der Originalbeitrag ist ursprünglich im Journal für Politische Bildung erschienen. Ausgabe 04/2022
Der Artikel beschreibt die Herausforderungen der sozial-ökologischen Transformation aus der Sicht von Arbeitnehmenden und das Dilemma zwischen ökologischem Bewusstsein und dem Erhalt des sozialen Status. Er skizziert exemplarisch die Rolle von Gewerkschaften und die Aufgabe von gewerkschaftspolitischer Jugend- und Erwachsenenbildung als Bestandteil einer gesellschaftlichen Diskussion wie wir zukünftig leben und arbeiten wollen.
"There are no jobs on a dead planet."
Dieser Satz stammt von Judy Bonds. Sie war Arbeiterin und Umweltaktivistin, die für ihr Engagement vielfach angefeindet wurde. Er wurde inzwischen vielfach aufgegriffen, nicht zuletzt von Gewerkschaften.
"Fuck you, Greta"
Diese Aussage gibt es auf Aufklebern zu lesen, wie auch auf einem SUV, der vor einem gewerkschaftlichen Bildungszentrum abgestellt war. Sie bezeichnet eine nicht selten anzutreffende Haltung gegenüber engagierten Umweltschützer*innen. Sie drückt damit nicht nur das Missfallen über den ‚Hype‘ um die Fridays for Future Bewegung aus, sondern diese Bewegung wird als Bedrohung des erreichten Lebensstils wahrgenommen. Der versprochene Aufstieg durch harte Arbeit sowie das Versprechen auf ein ‚gutes Leben‘ gerät in Gefahr. Die mit der sozial-ökologischen Transformation einhergehenden Diskussionen und Veränderungen lösen große Ängste und Sorgen bei den abhängig beschäftigten Menschen aus. Den Menschen ist bewusst, dass der Status Quo nicht bestehen bleiben kann. Gleichzeitig wollen sie daran festhalten. Engagierte Umweltschützer*innen sind als Überbringer*innen der schlechten Nachricht das Ziel der Wut über den drohenden Verlust an Sicherheit und Status. Die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung hat in ihrer Umfrage als Bedrohung für das Land den Rechtsextremismus, den Klimawandel und die soziale Spaltung als die drei wichtigsten Herausforderungen beschrieben (vgl. Schröter 2021: 27). Bei den Befragten mit geringem Einkommen war die soziale Spaltung die wichtigste Bedrohung. Die Befürchtung der Menschen, im Sog der permanenten Veränderungsprozesse am Ende sozial noch schlechter gestellt zu sein, führt auch dazu, alternativen Erklärungsmodellen Glauben zu schenken. Auch Gewerkschaftsmitglieder sind nicht gefeit vor alternativen Fakten, Verschwörungserzählungen oder der Leugnung des menschengemachten Klimawandels. Ein anderer Abwehrmechanismus ist der unkritische Glaube an die Technik. Zu gern wird die neoliberale Erzählung geglaubt, dass eine technische Innovation die Klimakatastrophe verhindern wird, um am eigenen Lebensstil nichts verändern zu müssen.
Rolle der Gewerkschaften
In diesem Dilemma zwischen Festhalten am Status Quo und der Erkenntnis, dass nur Veränderung eine nachhaltige Lebensform sichert, könnten Gewerkschaften ein Garant dafür sein, dass die Umgestaltung unserer Wirtschafts- und Lebensweise mit sozialer Sicherheit, demokratischen Aushandlungsprozessen und betrieblicher Mitbestimmung verknüpft wird. 1992 stellten die Vereinten Nationen die Bedeutung der Gewerkschaften in der Agenda 21 fest: „Als ihre Interessenvertreter kommt den Gewerkschaften auf Grund ihrer Erfahrungen mit dem industriellen Wandel, auf Grund der außer[1]ordentlich hohen Priorität, die sie dem Schutz der Arbeitsumwelt und der damit zusammenhängenden natürlichen Umwelt einräumen, und auf Grund ihres Engagements für eine sozial verantwortliche wirtschaftliche Entwicklung eine wichtige Funktion dabei zu, die Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung zu erleichtern“ (Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung 1992: 293). Seitdem sind 30 Jahre vergangen.
DER WANDEL MUSS ZU DEN MENSCHEN PASSEN
Erst die Diskussion um den Kohleausstieg und die soziale Absicherung der dort Beschäftigten hat die Bedeutung der Gewerkschaften im Transformationsprozess wieder mehr in den Fokus gebracht. In der Kohlekommission konnte ein Ausstieg aus der Kohleverstromung mit einer sozialen Absicherung der Beschäftigten erreicht werden. Insbesondere durch berufliche Bildung sollen die in der Kohlebranche beschäftigten Menschen für andere Tätigkeiten qualifiziert, Übergänge ermöglicht sowie soziale Härten abgemildert werden. Auch wenn man über den Ausstiegstermin nicht glücklich sein muss, zeigt dies exemplarisch, dass die sozialen Interessen der Beschäftigten ernstgenommen werden müssen, um eine Transformation erfolgreich zu gestalten.
Im ‚ver.di Zukunftsprogramm Energie‘ äußert sich ein Betriebsrat zu diesem Prozess:
„Wandel kann etwas Bedrohliches sein, bis man das Gefühl hat, ihn bewältigen zu können. Wichtig ist immer, ein Bild davon zu haben, wie etwas funktionieren kann. Wichtig ist auch, Betroffene zu Beteiligten zu machen. Man kann Lösungen nicht diktieren, sondern nur gemeinsam entwickeln. Wir müssen uns auch mit der eigenen Rolle als Betriebsrat auseinandersetzen. Dazu gehören die Fragen: Welcher Betriebsrat wollen wir sein? Wollen wir Zukunft verhindern oder Zukunft gestalten? Wir haben uns für das Gestalten entschieden. Dazu musste das Verständnis auch im Gremium wachsen, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen. Das ist sowohl spannend als auch schwierig, denn auf jede Veränderung folgt normalerweise eine Konsolidierung. Bei der Geschwindigkeit der Veränderungsprozesse sind diese Konsolidierungsphasen kaum noch gegeben. Deswegen müssen wir den Wandel so gestalten, dass er zu den Menschen passt. Jetzt steht der Kohleausstieg bevor. Durch politische Entscheidungen gab es wenig Planungssicherheit. Wir mussten lernen, mit dieser Unsicherheit zu arbeiten. Die Kraftwerker sind sehr verbunden mit ihrem Arbeitsplatz und legen viel Herzblut in ihre Arbeit. Trotzdem sagen sie: Wir können nicht nur Kohle, ihr müsst uns nur neue Aufgaben geben. Beschäftigungssicherung ist den Kolleg*innen am wichtigsten, diese Sicherheit ist ein Grundbedürfnis. Das begründet sich unter anderem durch ein hohes Durchschnittsalter. Insbesondere ältere Kolleg*innen wissen: Wenn der Arbeitsmarkt dich jetzt ausspuckt, wird es schwer, wieder Fuß zu fassen. Aber auch jungen Kolleg*innen ist diese Sicherheit viel wert. Sie wünschen sich Sicherheit für Familienplanung und Aufbau einer Existenz. Darüber hinaus besteht ein gesteigertes Bedürfnis nach einer ausgewogenen Work-Life-Balance und einem erfüllten Beruf mit guten Perspektiven. Bei der derzeitigen Fachkräftesituation haben sie alle Berechtigung, diese Bedürfnisse auch einzufordern!“ (vgl. ver.di 2022)
Den Betriebsrät*innen in diesem Energieunternehmen gelang es gemeinsam mit ver.di über einen Haustarifvertrag eine Beschäftigung zu garantieren, Ausbildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen zu vereinbaren und so den Wandel mitzugestalten
ARBEIT STIFTET IDENTITÄT
Arbeit, so wird es auch in dem Beispiel deutlich, ist nicht nur Lohnerwerb, sondern wird mit ‚Herzblut‘ verbunden und stiftet Identität. Über die Bedeutung von Arbeit und die Veränderung dieses Bezugspunktes gilt es zukünftig zu diskutieren und zu fragen, was dem Gemeinwohl hilft und wie diese Arbeit zu entlohnen ist. Dabei wird die sozial-ökologische Frage auch als Gerechtigkeitsfrage empfunden. Für eine Akzeptanz der Transformation müssen die Kosten und Lasten gerecht verteilt und die Perspektive auf ein ‚gutes Leben‘ erhalten werden. Gewerkschaften machen hier mit dem Konzept der Wirtschaftsdemokratie weitreichende Vorschläge (vgl. Schmitz/Urban 2021). Arbeitszeitverkürzung, die öffentliche Bereitstellung von Energie, Wasser, Verkehr, Wohnen, personenbezogener Dienstleistungen (Gesundheit, Pflege, Bildung, Erziehung) muss in gewerkschaftlichen Bildungsveranstaltungen zur Diskussion gebracht werden.
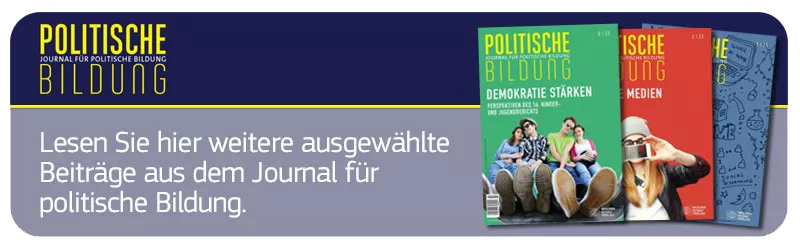
Kooperationen mit Umweltverbänden
Dass prekäre und schlechte Arbeitsbedingungen die sozial-ökologische Transformation behindern, wird sehr gut im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) deutlich. Seit der Einführung des europäischen Wettbewerbs Anfang der 2000er Jahre haben sich in Folge von Privatisierungen und Einsparungen die Arbeitsbedingungen so verschlechtert, dass Fachkräfte in diesem Bereich fehlen. Während der Personenverkehr 61 Millionen Tonnen CO2-Emissionen bis 2030 reduzieren muss, scheitert der Ausbau des ÖPNV daran, dass nicht ausreichend Fachkräfte zu den Arbeitsbedingungen und für diese Entlohnung dort arbeiten wollen.
ver.di hat in der Tarifkampagne 2020 das Ziel einer deutlichen Verbesserung und Anpassung der unterschiedlichen Tarifverträge gesetzt. Christine Behle und Mira Ball (2022) haben diese Kampagnen ausführlich analysiert. Neben dem Thema Entgelt ging es vor allem um die belastenden Arbeitsbedingungen. In dieser Tarifkampagne ging ver.di auch eine Zusammenarbeit mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), dem ökologischen Verkehrsclub Deutschland (VCD) und Fridays for Future ein. Dabei wurde eine Brücke zwischen dem akademisch geprägten Milieu von Fridays for Future und den streikenden Aktivisten*innen aus den Verkehrsbetrieben gespannt. Unter dem Slogan #wirfahrenzusammen fanden im Verlauf der Tarifkampagne in über 30 Städten Gewerkschafter*innen und Klimaaktivist*innen zusammen. Neben zwei bundesweiten gemeinsamen Aktionstagen im Juli und August 2020 mit Betriebsbesuchen und Kundgebungen fanden etliche weitere Aktivitäten statt. Diese Tarifbewegung ist ein gutes Beispiel für das Bündnis gesellschaftlicher Bewegungen, die eine Transformation ökologisch sinnvoll und sozial gerecht gestalten will.
Gewerkschaftliche Bildungsarbeit
Gewerkschaftliche Bildungsarbeit in ver.di nimmt diese Best Practice Beispiele auf und transportiert sie in die Organisation und Gesellschaft. Ziel ist es, die Lernenden zu befähigen, die Herausforderungen der Klimakatastrophe auf ihren Betrieb und in die Gesellschaft zu übertragen. Die politische Bildung in ver.di gibt dabei den Ängsten und Sorgen von Beschäftigten einen Raum und ermöglicht über regelmäßige Diskussions- und Online-Formate den Austausch über die Transformation unserer Arbeits- und Lebenswelt. Der Austausch über prekäre, unsichere Beschäftigung und Arbeitszeitmodelle wird dabei ebenso thematisiert, wie unser Konsumverhalten und unsere Mobilität. In einer Online Reihe werden grundlegende Themen angesprochen, die in Bildungsurlaubsseminaren oder in Seminaren für Betriebs- und Personalräte vertieft werden können. Es geht zunächst darum, das Wissen und die Informationen über die Klimakatastrophe weiter zu verbreiten und Mythen zu begegnen. Gleichzeitig sollen Strategien für Nachhaltigkeit entwickelt und Handlungsmöglichkeiten in den Betrieben und im gesellschaftlichen Alltag erarbeitet werden. Gewerkschaftliche Bildungsarbeit qualifiziert Betriebs- und Personalräte für die Begleitung und Gestaltung von Veränderungsprozessen, sie informiert über die Auswirkungen und Folgen der Klimakatastrophe, bietet Raum und Reflexionsmöglichkeiten für Ängste und Verunsicherungen und entwickelt Gestaltungs- und Handlungsmöglichkeiten.
Ausblick
Es besteht kein Zweifel: Die sozial-ökologische Transformation ist die zentrale Herausforderung unserer Zeit. Ob es uns gelingt, die Klimakatastrophe abzuwenden oder zumindest abzumildern entscheidet darüber, wie wir und zukünftige Generationen leben und arbeiten werden. ver.di organisiert als Gewerkschaft ca. 1,9 Millionen Mitglieder im Dienstleistungsbereich und ist die zweitgrößte Gewerkschaft in Deutschland. In ver.di finden sich seit 2001 Beschäftigte mit rund 1000 Berufen vom Friseur über die Finanzdienstleiterin zum Freiberufler, von der studentischen Hilfskraft bis zur Professorin, vom Krankenpfleger zur Erzieherin.
ARBEIT NEU BEWERTEN
Die Klimakatastrophe zeigt Auswirkung in allen Organisationsbereichen von ver.di. Ob es um nachhaltige Finanzinstitute, die Lieferketten im Handel oder die Aufwertung von Pflegearbeit geht, überall geht es um die Frage, wie wir uns die zukünftige Arbeits- und Lebenswelt vorstellen und wie wir Arbeit neu bewerten wollen. Der ver.di Bundeskongress hat 2019 in einem Leitantrag zum Thema „Nachhaltige Wirtschaft und aktiver Staat“ formuliert: „Unsere gewerkschaftliche Aufgabe ist es, betriebs- und tarifpolitisch dafür zu sorgen, dass die ökologische Transformation einher geht mit mehr guter Arbeit und sozialer Sicherheit. Dabei ist die Umweltbewegung ein wichtiger Bündnispartner. Der ökologische Umbau ist in erster Linie eine politische Gestaltungsaufgabe. Wir haben konkrete Vorstellungen, wie eine solche sozial-ökologische Politik ausgestaltet werden muss, und werden uns dafür stark machen.“
Damit hat er Beschlüsse und Forderungen aus früheren Gewerkschaftstagen bekräftigt. Über seine Bildungsträger ist ver.di gleichzeitig einer der größten Anbieter von politischer Jugend- und Erwachsenenbildungsarbeit in Deutschland. Angesichts der Folgen der Klimakatastrophe müssen nicht nur aktuelle Transformationsprozesse durch die Bildungsarbeit begleitet werden, sondern auch Raum für Utopien und Zukunftsvisionen geschaffen werden (vgl. Göbel 2021). Politische Bildungsarbeit kann die Frage aufnehmen und bearbeiten, wie wir zukünftig leben und arbeiten wollen.
Literatur:
Behle, Christine/Ball, Mira (2022): ÖPNV – Gute Arbeit für das Klima. In: Schmitz, Christoph/Urban, Hans-Jürgen (Hg.): Gute Arbeit Ausgabe 2022 – Arbeitspolitik nach Corona. Probleme, Konflikte, Perspektiven. Frankfurt/M., S. 283–293.
Göpel, Maja (2021): Unsere Welt neu denken. Berlin.
Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (1992): Agenda 21. Rio de Janeiro. Online abrufbar: https://t1p.de/hxmh
Schmitz, Christoph/Urban, Hans-Jürgen (Hg.) (2021): Demokratie in der Arbeit – Eine vergessene Dimension der Arbeitspolitik? Frankfurt/M.
Schröter, Franziska (Hg.) (2021): Die geforderte Mitte, Rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland. Bonn.
ver.di (2022): ver.di Zukunftsprogramm Energie. Online abrufbar: https://t1p.de/1zj1y Alle Internetquellen abgerufen am 22.8.2022.
Dieser Beitrag ist digital auffindbar unter: DOI https://doi.org/10.46499/1931.2558




