Biographische Interviews als Methode der Bildungsforschung

Lesedauer circa fünf Minuten - Lesen, liken und kommentieren!

Biographisch-narrative Interviews als Meilenstein der Integrationsforschung
Biographisch-narrative Interviews werden häufig verwendet, um Daten für die Analyse der Lebenswege einer Person zu generieren. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass die Biographie eines Menschen eine Synthese aus sozialen und individuellen Faktoren darstellt, die seine Lebensgeschichte prägen. Die Analyse von Biographien ermöglicht es uns daher, sensibel auf innere Triebkräfte des Verhaltens einer Person, den Einfluss ihres sozialen Umfelds, sowie auf die Auswirkungen größerer sozialer, wirtschaftlicher und politischer Trends zu reagieren. Der Nutzen biographischer Methoden zur Analyse der Situation von Arbeitsmigrant*innen ist nicht neu. Tatsächlich ist einer der Meilensteine der modernen Migrationsforschung gleichzeitig ein Meilenstein der biographischen Forschung in den Sozialwissenschaften. Die Studie „The Polish Peasant in Europe and America“, die fünf Bände umfasste und erstmals 1918 von William Isaac Thomas und Florian Znaniecki veröffentlicht wurde, enthält einen Band, der sich mit dem „Life Record of an Immigrant“ befasst. In diesem Buch analysieren Thomas und Znaniecki Briefe und andere biographische Quellen, um einen tieferen Einblick in die sozialen Strukturen und persönlichen Erfahrungen zu erhalten, die für das Phänomen der Migration von Polen in die USA eine Rolle spielen. In Bezug auf die Auswahl der Daten bemerken die Autoren:
„In analyzing the experiences and attitudes of an individual we always reach data and elementary facts which are not exclusively limited to this individual’s personality but can be treated as mere instances of more or less general classes of data or facts, and can thus be used for the determination of laws of social becoming“ (S. 6)
Etwas weiter unten auf der gleichen Seite führen sie aus:
„We are safe in saying, that personal-life records, as complete as possible, constitute the perfect type of sociological material, and that if social science has to use other materials at all it is only because of the practical difficulty of obtaining at the moment a sufficient number of such records to cover the totality of sociological problems, and of the enormous amount of work demanded for an adequate analysis of all the personal materials necessary to characterize the life of a social group“ (S.6-7)
Man muss die Hierarchisierung der biographischen Daten als wichtigste soziologische Daten durch die Autoren nicht teilen, um den Vorzug eines biographischen Ansatzes für die Erstellung umfassender soziologischer Daten zu erkennen. Denn der Lebensweg einer Person wird unweigerlich von deren sozialer Umwelt geprägt und Daten, die diesen Lebensweg betreffen geben daher immer zugleich über dessen soziale Umwelt Auskunft. Darüber hinaus erlaubt die biographische Forschung eine vertiefte Analyse, die andere Daten so nicht zulassen.

Lizensiert unter CC0 1.0 Universell (CC0 1.0)
Austausch auf Augenhöhe, kein Verhör
Ein weiterer Vorteil der Verwendung von biographisch-narrativen Interviews als Methode zur Datenerhebung besteht darin, dass die Befragten (in unserer Studie verwenden wir den Begriff „Interviewpartner*innen“, der den gemeinsamen Anteil an der Gestaltung des Interviews hervorhebt) mehr Kontrolle über den Interviewprozess haben. Indem Menschen ihre Geschichte ohne Unterbrechung erzählen können, und Rückfragen aus der Erzählung abgeleitet werden, kann eine „Verhöratmosphäre“ vermieden und Misstrauen überwunden werden. Dies ist besonders wichtig, wenn man mit Interviewpartner*innen aus einer Gruppe spricht, die häufig Feindseligkeiten ausgesetzt sind, zum Beispiel mit Arbeitsmigrant*innen.
Die von uns geführten biographisch-narrativen Interviews haben uns in unsere Wahl der Interviewmethode bestätigt. Sie haben uns umfangreiche Daten geliefert und wir haben immer wieder positive Rückmeldungen von unseren Interviewpartner*innen erhalten.
Analysiert wurden und werden die Interviews derzeit mit der Grounded Theory Methodologie (zu dieser Methodologie bald mehr auf EPALE). Wir freuen uns darauf, die resultierende bildungssoziologische Studie – und damit eine Theorie arbeitsmigrantischer Bildungsbedarfe – Ende Mai vorzustellen.
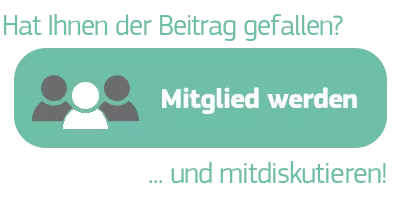
Über den Autor: Dominik Hammer ist Projektmitarbeiter der Katholischen Erwachsenenbildung im Lande Niedersachsen e.V. Im Erasmus+ Projekt NAMED erforscht der Politikwissenschaftler derzeit die Bildungsbedarfe von Arbeitsmigrant*innen. Auf Epale wird er regelmäßig über den Forschungsprozess und das Projekt berichten.
Lesen Sie hierzu auch:
Kommunale Integrationsprozesse managen: Von europäischen Partnern lernen
Strategische Inklusion von Migrant*innen in die Programmentwicklung der Erwachsenenbildung
Appetite for Enterprise: Migrantinnen entdecken ihre unternehmerischen Fähigkeiten




