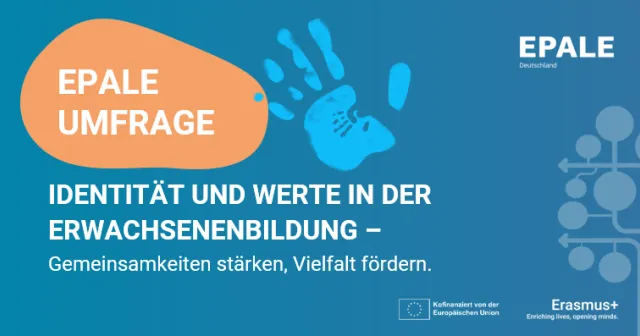Wahrecht oder Wahlpflicht?
Der Stellenwert der Wahl
Es gibt eine Vielzahl verschiedener Herrschaftsformen, die das menschliche Zusammenleben regeln (sollen). Heute am weitesten verbreitet sind Monarchien, Autokratien und Demokratien. Diese Modelle lassen sich teilweise miteinander in Verbindung bringen, sie überschneiden sich, bringen Mischformen hervor und lassen sich weiter unterteilen. In Bezug auf Demokratien ist insbesondere die Unterteilung zwischen direkter und repräsentativer Demokratie an dieser Stelle von Interesse. Die meisten heutigen Demokratien beinhalten sowohl direkte als auch repräsentative Elemente, wobei Letztere zumeist deutlich ausgeprägter sind. Elemente direkter Demokratie sind zum Beispiel Referenden und Volksentscheide. Doch das politische Alltagsgeschäft basiert in den meisten Fällen auf repräsentativer Demokratie, und diese basiert auf Wahlen.
Wahlen stellen einen wichtigen Bestandteil und eine Voraussetzung für das Funktionieren repräsentativer Demokratien dar. Wahlen ziehen sich durch verschiedene politische Ebenen, von der lokalen Ebene über die nationale bis hin zur europäischen Ebene. Gemeinhin gelten Demokratien heute als die beste Herrschaftsform (eine andere Frage, um deren inhaltliche Beantwortung es in diesem Beitrag nicht geht). Der Ansatz ist, dass die Macht vom Volk ausgehen soll. Zu diesem Zweck wählt das Volk seine Volksvertreter. Dabei kann unterschieden werden danach, ob das Volk freiwillig wählt, sprich ob es jedem selbst überlassen bleibt, ob er wählt, oder ob es eine Wahlpflicht gibt, sprich dass jeder Wahlberechtigte auch wahlverpflichtet ist, was man wiederum danach unterscheiden kann, ob diese Wahlpflicht formell-symbolischen Charakter hat, also faktisch nicht sanktioniert wird, oder ob die Wahlpflicht tatsächlich mit Repressalien durchgesetzt wird. Die gewählten Volksvertreter sollen dann, so die Theorie, im Rahmen der Zuständigkeit der jeweiligen Ebene, den Willens des Volkes durchsetzen.
An dieser Stelle sei ein kleiner Einschub gestattet: es gibt Länder mit repräsentativer Demokratie, die ohne Wahlpflicht funktionieren, zum Beispiel Deutschland, und es gibt solche, die mit Wahlpflicht funktionieren, beispielsweise Belgien. Im Rahmen juristischer Auseinandersetzungen mit der Thematik der Wahlpflicht gilt für das eine Land nicht dasselbe wie für ein anderes, denn die Nationalstaaten unterliegen ihren eigenen Gesetzen, die sich historisch, kulturell und politisch voneinander unterscheiden. So ist das gängige Argument, eine Wahlpflicht müsse rechtlich zulässig sein, dies sei sie in anderen Ländern ja auch, für ein bestimmtes Land deshalb nicht stichhaltig. In diesem Beitrag soll es denn auch nicht um die juristische Anwendbarkeit oder Vertretbarkeit einer Wahlpflicht gehen, sondern es wird sich theoretisch-abstrakt mit der Frage beschäftigt, ob eine pauschale Antwort gegeben werden kann, welcher dieser beiden Optionen die bessere ist, eine repräsentative Demokratie mit oder ohne Wahlpflicht.
Die Theorie von Recht und Pflicht
In einer überwiegenden Mehrzahl der heutigen Demokratien gibt es keine Wahlpflicht. Bereits von der Begrifflichkeit her lässt sich ein Widerspruch ausmachen: „Wahl“ und „Pflicht“, das sind gewissermaßen Gegensätze, wer zu etwas verpflichtet ist, hat diesbezüglich keine Wahl. Vielleicht aus diesem Ursprung heraus ergibt es sich, dass das spontane Verständnis von Wahlrecht das der bewussten Entscheidung eines jeden wahlberechtigen Bürgers hin zu einer aktiven Wahlentscheidung ist. Bei der gesetzlichen Verankerung eines Wahlrechts mag gar nicht erst der Gedanke aufgekommen sein, dieses Recht an eine Pflicht zu knüpfen. Im Sinne der Demokratie als einer Herrschaftsform, die den Bürger als Bestandteil des Volkes in den Mittelpunkt stellt und ihm größtmögliche Freiheit und Autonomie zugestehen will, kann auch argumentiert werden, dass dem Bürger nicht mehr Zwang auferlegt werden kann, als zwingend für das Funktionieren des Systems erforderlich ist. So gesehen kann das Wahlrecht als erster Versuch in einem demokratischen System angesehen werden. Die Wahlpflicht wäre eine sich anschließende Konsequenz in den Fällen, in denen von dem Recht zur Wahl nicht ausreichend Gebrauch gemacht wird, um die Funktionsweise des Systems aufrechtzuerhalten, das heißt: in den Fällen, in denen die freiwillige Wahlbeteiligung zu gering ist, um eine angemessene Repräsentation des Volkes zu gewährleisten – welcher Prozentsatz an Wahlbeteiligung auch immer konkret derjenige wäre, anhand dessen festgemacht wird, ob eine Repräsentation noch ausreichend ist oder eben auch nicht.
Konsequenz dieses Ansatzes wäre, dass ein Wahlrecht in jenen demokratischen Systemen, in denen die Wahlbeteiligung unter einen gewissen Schwellenwert fällt, durch eine Wahlpflicht ersetzt wird. Diesen Mechanismus könnte man natürlich beliebig verfeinern. Für den Schwellenwert könnte zum Beispiel der Durchschnitt der Wahlbeteiligung der letzten x Jahre veranschlagt werden, die Wahlpflicht ihrerseits könnte auch unterschiedliche Ausgestaltungen annehmen, von der genauen Definitionen derer, die von ihr erfasst werden, über Schwere und Grad der Sanktionen im Falle der Nichteinhaltung.
Eine kurze Historie
Die Realität sieht freilich anders aus. In vielen Ländern ist die Wahlbeteiligung, und das bereits über einem längeren Zeitraum, auf einem so niedrigen Niveau, dass durchaus davon ausgegangen werden kann, dass ein solcher Schwellenwert unterschritten wäre, die Zunahme populistischer und rechtsextremer Tendenzen, die sich in der Parteilandschaft spiegeln, unterstützen diese These. Andersherum ist nicht festzustellen, dass in den Ländern, in denen es eine Wahlpflicht gab oder noch gibt, diese konkret als Reaktion auf unzureichendes Nutzung des Wahlrechts zurückzuführen ist. Tatsächlich gab es unterschiedlichste Erwägungen und Ursachen, teils moralischer, teils politischer Natur für die Einführung einer Wahlpflicht:
- Australien führte die Wahlpflicht nach dem Ersten Weltkrieg ein. Im Krieg waren über 60.000 Australier gefallen, es wurde als eine Pflicht im moralischen Sinne des Wortes angesehen, diese so hart und mit so vielen Verlusten erkämpfte Freiheit wahrzunehmen, allein schon aus Respekt und Ehrerbietung den Gefallenen gegenüber.
- In Österreich, welches die Wahlpflicht 1992 gänzlich abschaffte, war die Einführung derselben auf politisches Kalkül zurückzuführen: mit der Einführung des Frauenwahlrechts war die Angst der damaligen konservativen Christlichsozialen Partei verbunden, es würde den Sozialdemokraten besser gelingen, Frauen zur Stimmabgabe zu motivieren, was die Mehrheitsverhältnisse geändert hätte.
- In Belgien besteht die Wahlpflicht bereits seit 1893. Zum Vergleich: das allgemeine Frauenwahlrecht wurde erst 1948 eingeführt. Auch wenn das Wahlrecht in Belgien bereits mit der Staatsgründung 1831 eingeführt worden ist, wurde es erst nach Verfassungsreform 1893 auf die allgemeine (männliche) Bevölkerung ausgedehnt, zuvor war das Wahlrecht noch durch Eigentumskriterien eingeschränkt worden, sodass faktisch nur etwas über 1% der Männer über 25 Jahren wählen durften. Für die Allgemeinheit begann das Wahlrecht in Belgien also erst 1893, und ging sofort mit der Wahlpflicht einher. Faktisch wird eine Nichtwahl seit 2003 allerdings nicht mehr sanktioniert, sodass man fast schon davon sprechen kann, dass die belgische Wahlpflicht abgeschafft worden ist und es „lediglich“ (noch?) nicht in die entsprechenden Gesetze aufgenommen wurde. Ähnlich verhält es sich in Luxemburg, in dem zwar de facto Wahlpflicht gilt, die allerdings seit 1964 nicht mehr geahndet werden.
Bereits anhand dieser kurzen, exemplarischen und unvollständigen Auflistung lässt sich erkennen, dass es weder einheitliche Gründe für die Einführung einer Wahlpflicht noch für die Abkehr von einer Wahlpflicht gibt, sondern dass diese sich jeweils aus spezifischen historischen, kulturellen oder politischen Erwägungen beinahe schon ergeben haben.
Gründe dafür und Gründe dagegen
Gibt es denn nun allgemeingültige Gründe dafür oder dagegen, aus dem Wahlrecht eine Wahlpflicht zu machen? Die gibt es auf beiden Seiten, und beide Seiten sind bereits vielfach formuliert und zitiert worden.
Für eine Wahlpflicht spricht, dass sie ein wirksames Mittel gegen eine unzureichende Wahlbeteiligung darstellt. In den Ländern, in denen Wahlpflicht herrscht oder herrschte, gab und gibt es regelmäßig Wahlbeteiligungen von über 90%. Eine Wahlpflicht ist zwar keine Garantie, macht aber zumindest wahrscheinlicher, dass die Wähler sich mit den zur Auswahl stehenden Parteien, Kandidaten und Programmen auseinandersetzen, um eine fundierte Wahl zu treffen. Damit geht ein genaueres Abbild der gesellschaftlichen Meinung im Wahlausgang einher, die gewählten Volksvertreter sind demokratisch legitimierter als sie es andernfalls wären. Im Falle einer Wahlpflicht werden weniger Ausgaben für Wahlkampagnen getätigt, was den Einfluss von Spendengebern auf Parteien und Politik verringert. Es wird auch, wie im obigen Beispiel Australiens, eine moralische Pflicht angeführt.
Ein Gegenargument wäre, ebenfalls zunächst auf einer eher moralischen Ebene, dass eine Wahlpflicht in das Persönlichkeitsrecht eingreife, stellenweise auch in andere Rechte und Freiheiten, abhängig von Hintergrund und Kultur. Eine Wahlpflicht würde es unmöglich machen, durch eine Nichtwahl ein politisches Zeichen zu setzen. Außerdem würde eine Wahlpflicht nicht gewährleisten, dass eine bewusste, überlegte und fundierte Wahl getroffen wird, man könnte auch eine Zufallswahl treffen, die der Stärkung der Demokratie nicht dienlich wäre, oder einen leeren Zettel abgeben, womit eine Wahlpflicht zu einem Formalismus verkomme. Außerdem sei eine Wahlpflicht entweder nicht durchsetzbar in dem Sinne, dass sie zwar offiziell strafbewehrt ist, diese aber nicht durchgesetzt werden (wie in Belgien oder Luxemburg), womit die Wahlpflicht wiederum nicht mehr als Schein ist, oder die Durchsetzung der Sanktionen ist mit einem erheblichen Finanz- und Organisationsaufwand verbunden, da die Nichtwähler zunächst identifiziert und dann auch zur Rechenschaft gezogen werden müssen.
Zu den Argumenten beider Seiten gilt es, weitere Überlegungen anzustellen:
Was die moralischen Argumente angeht, sowohl in dem Sinne, dass es von politisch-juristischer Perspektive abgesehen auch eine inhärente „menschliche“ Pflicht sei, zu wählen, als auch in dem Sinne, dass es gerade keine Pflicht sein könne, weil es hierbei um eine sehr persönliche Ebene des individuellen Menschen geht, sei der Hinweis gestattet, dass Moral in sich letztlich menschengemacht ist. Wenn ein Staat aus einem Wahlrecht eine Wahlpflicht macht, stellt dies einen Zwang und damit einen Eingriff in die Freiheit des einzelnen wahlberechtigten (und dann auch wahlverpflichteten) Bürgers dar. Daraus aber pauschal die Konsequenz abzuleiten, der Staat dürfe das nicht tun, eben weil damit ein Zwang für Bürger einhergeht, würde das ganze System, in dem der Mensch lebt, infrage stellen. Denn tatsächlich übt der Staat in sehr vielen Lebensbereichen Zwang auf die Menschen aus. Was ist mit der Pflicht zur Entrichtung von Steuern? Was ist mit der Pflicht zur Einhaltung der Verkehrsvorschriften im Straßenverkehr, ja zur Unterlassung all der Handlungen, die strafrechtlich geahndet werden? Oder, wenn ein eher der Kultur zuzurechnendes Beispiel gewünscht ist: was ist mit dem Verschleierungsverbot, wie es in diversen Ländern, darunter auch Belgien und Deutschland gilt? In all diesen genannten und noch zahlreichen weiteren Bereichen übt der Staat Zwang auf den Bürger aus, und es ist sowohl anzunehmen als auch sehr stark zu hoffen, dass diese Eingriffsbereiche in den jeweiligen Staaten und auf überstaatlicher Ebene verfassungs- und gesetzeskonform sind. Wenn also diese Zwänge legitimierbar und begründbar sind, wieso sollte dann gerade ein Zwang, der die Grundlage der Demokratie stärken soll, nicht legitimierbar und begründbar sein? Achtung: damit soll nicht zum Ausdruck gebracht werden, dass eine Wahlpflicht per se zulässig sein muss, nur weil in anderen Bereichen staatlich ausgeübte Pflichten und Zwänge augenscheinlich rechtmäßig sind. Aber die Tatsache, dass staatlich ausgeübte Pflichten und Zwänge rechtmäßig sein können, heißt, dass das auch für eine Wahlpflicht gelten kann und dass eine pauschale Argumentation im Sinne von „ein Eingriff in das Persönlichkeitsrecht des Einzelnen kann nicht zulässig sein“ nicht ausreichend ist – erst recht im Hinblick auf die doch hoffentlich evidente Wichtigkeit der Thematik, nämlich der Motivation möglichst vieler zur Beteiligung an demokratischen Entscheidungsprozessen. Allerdings sollte der moralische Aspekt auch auf der Seite der Befürwortung einer Wahlpflicht nicht überbewertet werden, denn ihm haftet eine starke Wertung an, die zwangsläufig polarisieren muss.
Die Argumentation der Bekämpfung von Politikverdrossenheit ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist durchaus nachvollziehbar, dass eine Wahlpflicht den Bürger dazu anhält, sich über Kandidaten, Parteien und Programme zu informieren, wenn er ohnehin wählen muss, und das wäre ein Mechanismus, der der Politikverdrossenheit tatsächlich entgegenwirkt. Es ist aber nicht auszuschließen, dass Nichtwähler (im System des Wahlrechts) und Trotzwähler (im System der Wahlpflicht) sich den Zeitaufwand der Informierung sparen und zufällig wählen. Auch das wäre ein Aspekt der Politikverdrossenheit, der nur eine andere Ausprägung fände: anstatt eine geringe Wahlbeteiligung zu haben, weil die Politikverdrossenen nicht wählen, weil sie nicht müssen, oder einen Aufschwung populistischer Parteien zu erleben, weil die Bürger diese wählen, nicht weil sie sie wählen wollen, sondern weil sie die etablierten Parteien gerade nicht wählen wollen, käme vermutlich ein eher zufälliges und willkürliches Bild zustande. Die Frage zu formulieren, welche dieser Alternativen jetzt besser oder schlechter sei, ist müßig. Dieses Argument kann nicht klar bewertet werden, weil es zu sehr von der individuellen Verhaltensweise eines jeden Einzelnen abhängt.
Das Argument, bei einer Wahlpflicht würde es unmöglich gemacht, durch eine Nichtwahl ein politisches Zeichen zu setzen, vermag nicht zu überzeugen. Auch bei einer Wahlpflicht kann ein Bürger, der entweder aus Prinzip nicht wählen will oder weil ihn keine der zur Auswahl stehenden Alternativen ausreichend überzeugt, einen leeren oder ungültigen Stimmzettel abgeben. Damit hätte er seine Pflicht getan und würde seinen Standpunkt dennoch zum Ausdruck bringen.
Hinsichtlich der Durchsetzbarkeit einer Wahlpflicht ist zu unterscheiden zwischen der Version, in der die Wahlpflicht nur offiziell strafbewehrt ist, faktisch im Falle der Nichtwahl aber keine Sanktionen folgen und den Fällen, in denen die Durchsetzung der Sanktionen einen enormen Aufwand verursacht. Die erste Variante erscheint tatsächlich wenig zielführend. Strafen zu formulieren, die ohnehin niemals Anwendung finden werden, ist überflüssig. Die Fälle, in denen dieses System Anwendung findet, sind in erster Linie historisch zu erklären, wie oben erwähnt beispielsweise in Belgien oder Luxemburg, sodass hier eine ehemals bestehende Wahlpflicht de facto bereits abgeschafft wurde und der Gesetzgeber es lediglich noch nicht geschafft hat, die formalen Grundlagen dieser Tatsache anzupassen. Dennoch sollte der Gesetzgeber (im Normalfall das Parlament, welches auf Grundlage von Wahlrecht bzw. –pflicht zustande gekommen ist, wohlgemerkt) aus Gründen des Vertrauensschutzes des Bürgers in den Staat dafür Sorge tragen, dass die Gesetzgebung der Realität angepasst wird. Ebenso wie ein Bürger darauf vertrauen können muss, dass all das, was nicht ausdrücklich unter Strafe gestellt ist, auch nicht von Strafe bedroht ist, muss er auch darauf vertrauen können, dass all das, was unter Strafe gestellt ist, von Strafe bedroht ist, denn es sind zwei Seiten derselben Medaille. In jedem Fall erscheint das Konzept einer Wahlpflicht, die von vorneherein nur offiziell mit Sanktionen belegt ist, die aber ohnehin nie durchgeführt werden, nicht empfehlenswert, sodass die Alternative bliebe, die angedrohten Sanktionen im Falle der Nichtwahl auch tatsächlich durchzuführen. Sicherlich, das zöge einen enormen Organisations- und Verwaltungsaufwand nach sich. Dennoch, ist es so ausgeschlossen, ein effizientes System zu entwerfen? Der Grad des Aufwands hängt in erheblichem Maße von der konkreten Ausgestaltung der Wahlpflicht ab, die dem Gesetzgeber frei überlassen bliebe. Ein Beispiel: die tatsächlichen Sanktionen könnten eine Vielzahl konkreter Formen annehmen. Wenn man von einer Gefängnisstrafe ausgeht, ist der auch langfristige Aufwand sicherlich enorm, zumal hierdurch in einigen Ländern (wie beispielsweise Belgien) ohnehin schon überfüllte Gefängnisse weiter belastet würden. Die Verköstigung eines Gefängnisinsassen stellt darüber hinaus einen finanziellen Aufwand dar. Ohnehin erscheint eine solche Strafandrohung im Verhältnis zur Schwere der Schuld, wenn man sie denn überhaupt so nennen darf, drakonisch und ist in den meisten Ländern, in denen es aktuell eine Wahlpflicht gibt, auch nicht oder zumindest erst im Wiederholungsfall anzuwenden. Eine Geldbuße als Sanktion hingegen ist mit einem weniger langfristigen Aufwand verbunden und erhöht überdies die Staatseinnahmen. Es wäre sogar ein System denkbar, die Arbeitslosigkeit zu reduzieren, indem Arbeitsplätze konkret zur Überwachung und Sanktionierung der Wahlpflicht geschaffen werden, die aus den durch die Geldbußen eingenommenen Mitteln finanziert werden. Natürlich bliebe zu überprüfen, inwiefern das mit nationalen Gesetzgebungen vereinbar ist und ob letztlich ein angemessener Kompromiss gefunden werden könnte zwischen nicht zu hohen Geldbußen und einer doch angemessenen Entschädigung für diejenigen, die die Sanktionierung durchführen. Aber eine Wahlpflicht pauschal mit einem Verweis auf den Aufwand der Überprüfung und Sanktionierung abzulehnen, erscheint zu wenig differenziert und reflektiert.
Status quo
Die Argumente für und gegen Wahlrecht und Wahlpflicht lassen sich beinahe nach Belieben auslegen und interpretieren. Auf die Gefahr, dass dieser Beitrag gerade Erwartungshaltungen enttäuscht, wird auch hier keine eindeutige Antwort für oder gegen eine Wahlpflicht gegeben werden. Ein Blick auf die derzeitige globale Situation zeigt, dass die Anzahl der Länder mit Wahlpflicht abnimmt, ebenso scheint das allgemeine Verständnis der Bevölkerung für Wahlpflicht nachzulassen. Es ist jedoch nicht von der Hand zu weisen, dass die Wahlbeteiligung in Ländern mit Wahlpflicht deutlich höher ist als in Ländern ohne Wahlpflicht, was wohl als das stärkste aller Argumente gelten sollte.
Fazit
Auf den ersten Blick erscheint die Frage fast schon unwürdig, überhaupt gestellt zu werden. Wahlpflicht, man hört es schon im Wort, das ist ein Widerspruch, und zugegeben, eine Pflicht zur Wahl, wie jede andere Pflicht, widerspricht irgendwo dem freiheitlichen Grundgedanken der Demokratie. Dennoch, so widersprüchlich ist dieses Wort vielleicht gar nicht, denn auch wenn es Pedanterie sein mag, die „Wahl“ in „Wahlpflicht“ bleibt unberührt, es bleibt die Wahl zwischen den zur Auswahl stehenden Kandidaten und Parteien, man wird lediglich verpflichtet, diese Wahl auch zu treffen. Bleibt also der freiheitliche Grundgedanke, der auf der Strecke bleibt. Dieser Schwäche der Wahlpflicht ist auch mit spitzfindiger Paragraphenreiterei nicht beizukommen. Ja, eine Wahlpflicht übt Zwang aus, das ist eine Tatsache. Wie eingangs erwähnt, gilt die Demokratie heute als die beste Herrschaftsform. Falls dem tatsächlich so sein sollte, sollte vielleicht im gleichen Atemzug die Tatsache anerkannt werden, dass selbst das beste derzeit zur Verfügung stehende System nicht frei von Schwächen ist. Als eine solche Schwäche kann dann die Notwendigkeit gewisser Pflichten auch in einem freiheitlich orientierten System angesehen werden. Am Ende kann Demokratie nur funktionieren, wenn das Volk sich tatsächlich beteiligt. Ob das Volk das in Wahrnehmung eines Rechts oder in der Erfüllung einer Pflicht tut, ist für die Demokratie selbst unerheblich.
Werdegang
Ich arbeite seit November 2018 in der Nationalen Agentur für die europäischen Förderprogramme Erasmus+ und das Europäische Solidaritätskorps (angesiedelt im Jugendbüro der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens).
Zunächst zeichnete ich dort verantwortlich für die Bewertung und Bearbeitung der Anträge und Projekte in den Bereichen Schulbildung, Berufsbildung und Hochschulbildung. Seit Januar 2021 koordiniere ich darüber hinaus das Youth Wiki in der Deutschsprachigen Gemeinschaft, die Online-Enzyklopädie über die verschiedenen Jugendpolitiken in Europa. Im Januar 2022 gab ich die Bildungsbereiche ab und übernahm stattdessen den Jugendbereich (sowohl Erasmus+ als auch das Europäische Solidaritätskorps).
Vor meiner Zeit im Jugendbüro studierte ich Rechtswissenschaften an der Universität Trier mit einem Fokus auf internationalen Rechtssystemen. Außerberuflich bin ich gewerkschaftlich aktiv, weitere Interessen bilden Sprachen, Literatur, Kultur und Gesellschaft.
Weitere Veröffentlichungen
- Die Bildung in den Zeiten der Corona
- Über das Gerücht der Gleichheit der Menschen: Zugang zur Bildung
- Medienkompetenz – Grenzen und Möglichkeiten
- Corona und das Klima
- Was Mensch zum Leben braucht
- Die Kommunikation zwischen Lehrendem und Lernenden