Nicht-formale und informelle Bildung: Geschichte, aktuelle Themen und Fragen
[Übersetzung (Französisch - Deutsch) : EPALE Frankreich]
Interview geführt von Thierry Ardouin
Nicht-formale und informelle Bildung: Geschichte, aktuelle Themen und Fragen
Guten Morgen, Frau Stéphanie Gasse, in dieser Zeit der weltweiten Krise sind Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen gezwungen, neue Wege der Arbeit, der Verbreitung und der Ausbildung zu erfinden. Gleichzeitig helfen und unterstützen sich die Menschen gegenseitig, kurz gesagt, sie organisieren sich, um technische, inhaltliche und relationale Mängel auszugleichen. Das Thema der nicht-formalen Bildung und des lebenslangen Lernens ist umso präsenter.
Fortsetzung des Schwerpunkts zu nicht-formaler und informeller Bildung, der von EPALE im Juni und Juli 2019 durchgeführt wurde. Sie haben eine Ausgabe der Fachzeitschrift Education Permanente zum Thema „Nicht-formale Bildung und lebenslanges Lernen“ (Nr. 199/2014) koordiniert, ich würde gerne mehr darüber erfahren und Ihre Einschätzung kennen lernen, denn diese Dimensionen stellen die Erwachsenenbildung im Allgemeinen in Frage, und diese Themen sind auf der EPALE-Plattform wichtig.
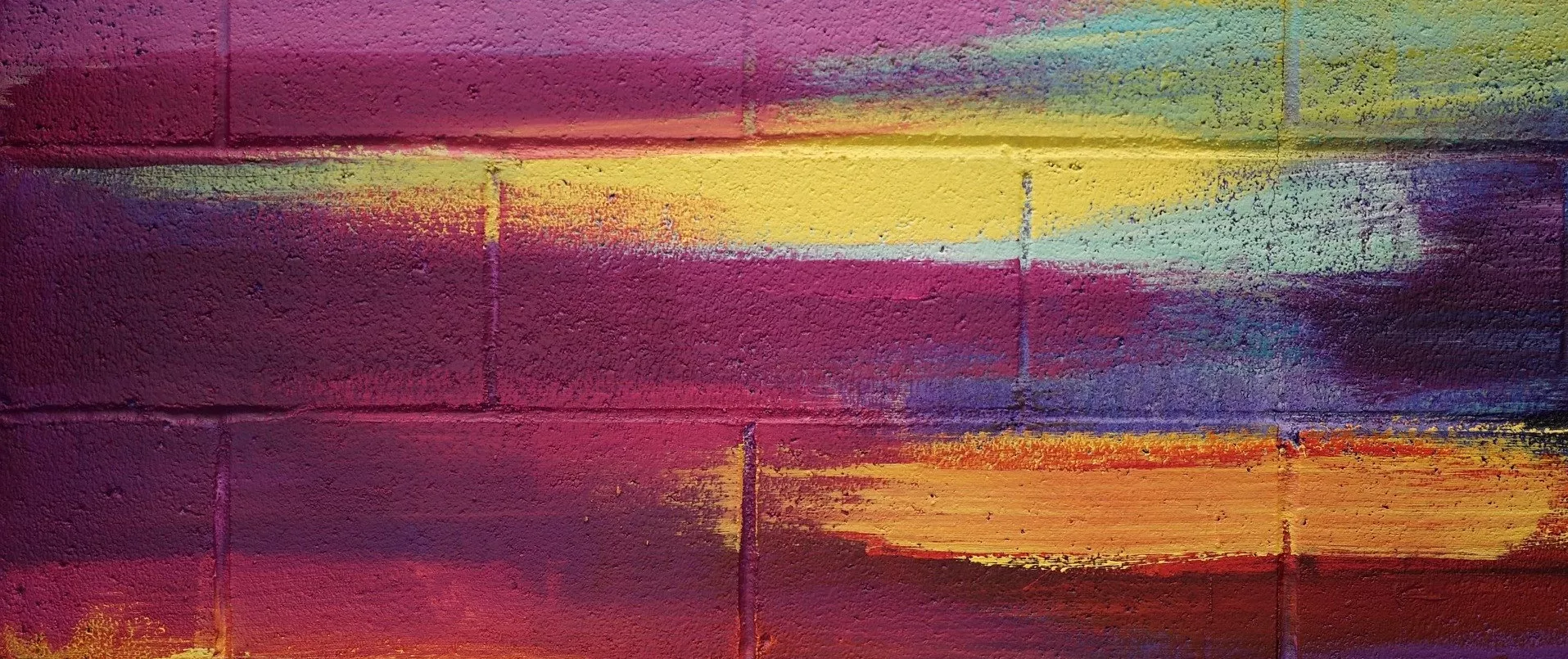
- Können Sie uns zunächst etwas mehr über sich selbst erzählen und uns sagen, was Sie dazu bewogen hat, sich mit der nicht-formalen Bildung zu befassen?
Ich habe ein Diplomstudium in Fremdsprachen absolviert und mich dann schnell den Erziehungswissenschaften zugewandt. Ich habe einen Master-Abschluss in Ausbildungstechniken und -beratung gemacht und anschließend im Rahmen von Bildungsprojekten, die zwischen 1999 und 2003 unter der Schirmherrschaft der UNESCO (Burkina Faso, Mali, Paris) und von NRO im Bildungsbereich durchgeführt wurden, Feldversuche durchzuführen. Nach meiner Promotion in Erziehungswissenschaften begann ich 2008 als Ausbilderin am Institut du Développement Social, mitten in der Reform der Sozialarbeitsdiplome und im Rahmen der Neugestaltung, Bewertung und Entwicklung von Ausbildungsgängen am Répertoire National des Certifications Professionnelles (Verzeichnis der Berufsabschlüsse).
Ich bin seit 2010 als Dozentin im Fachbereich Erziehungswissenschaften der Universität Rouen-Normandie tätig und leite den Masterstudiengang Fernlernwissenschaften. Während meiner Forschungsarbeit und in Verbindung mit meinen gesammelten Erfahrungen habe ich mich sehr schnell in der Bildungspolitik positioniert, indem ich mich auf Länder konzentrierte, die eine starke Dezentralisierung des Bildungswesens betreiben. Meine Dissertation in Erziehungswissenschaften befasst sich mit der nicht-formalen Bildung im Kontext der Dezentralisierungspolitik in Westafrika im Kampf gegen den Analphabetismus. Mein Beobachtungs- und Experimentierfeld sind pädagogische NGOs (Nichtregierungsorganisationen), CSOs (Organisationen der Zivilgesellschaft) und Experten der dezentralisierten Zusammenarbeit.
Als Mitglied des CIRNEF-Labors(Centre Interdisciplinaire de Recherche Normand en Education et Formation) führe ich meine Forschung an der Seite von Forschern durch, die im Bereich der Erwachsenenbildung tätig sind. Ich versuche zu definieren, was die nicht-formale Bildung, ihre Spezifität und Umsetzung charakterisiert, ich untersuche alternative Systeme, die Grundlagen der Erwachsenenbildung und die Andragogik in ihren Varianten und Variationen und leiste gleichzeitig einen Beitrag zu einer Reflexion über das Recht auf Bildung (Zugänglichkeit, Effektivität durch Fernunterrichtssysteme) und die Themen Recht, vergleichende Ansätze, Organisationsentwicklung.
Meine Forschungsgebiete sind nach wie vor Subsahara-Afrika und „Programme zur Bekämpfung des Analphabetismus in einem dezentralisierten Kontext“, Brasilien mit dem „EYPA-Forum - Jugend und Erwachsenenbildung“, Europa durch seine pluralen Ansätze in der allgemeinen und beruflichen Bildung (Erwachsenenbildung - Lebenslanges Lernen - Recht auf Bildung - Anerkennung von nicht-formalen Bildungsleistungen).
Als Gewinnerin eines Lehrstuhls für Human- und Sozialwissenschaften der internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit für 2015 und 2016 lebte ich in Brasilien und war an der Universidade do Estado do Rio de Janeirotätig, der ersten öffentlichen Universität mit einer positiven Politik für die Entwicklung des Zugangs zur Hochschulbildung. Diese Erfahrung bildete die Basis, um seitdem mit brasilianischen Forschern in Forschungsgruppen in den Bereichen Alphabetisierung und Jugend- und Erwachsenenbildung, Ausbildungslehrplan, lebenslanges Lernen durch Zielgruppen, Bildungspolitiken und -prozessen zusammenzuarbeiten.
- Der Begriff nicht-formale Bildung ist etwas schwierig zu definieren, wie verhält er sich zu formaler und informeller Bildung? Wann und in welchem Zusammenhang ist dieser Begriff Ihrer Kenntnis nach aufgetreten? Welche Merkmale oder Elemente sollten beibehalten werden?
Nicht-formale Bildung ist in der Tat schwer zu definieren, da sie scheinbar die Form verneint und die Unklarheit, die sie kennzeichnet, nicht berücksichtigt. Sie erscheint einerseits etwas schwammig, andererseits als ein von Perspektiven der sozialen Gerechtigkeit und der humanistischen Ideologie geprägter Ansatz.
Nicht-formale Bildung findet außerhalb der Hauptstrukturen der allgemeinen und beruflichen Bildung statt und führt nicht unbedingt zu anerkannten Qualifikationen und Abschlüssen. Sie kann in einem professionellen Kontext oder durch die Aktivitäten zivilgesellschaftlicher Organisationen erworben werden und kann als Ergänzung zum formal institutionalisierten System angeboten werden. Coombs, ein Bildungsplaner, machte den ersten Versuch einer Definition im Zusammenhang mit der globalen Bildungskrise: „Jede pädagogische Aktivität, die außerhalb des etablierten formalen Bildungssystems organisiert wird und darauf ausgerichtet ist, identifizierbaren Zielgruppen (Klienten) und Bildungszielen zu dienen“(Coombs, 1973). Der Begriff des Klientelismus ist mit den „Begünstigten/Empfängern“ von Alphabetisierungsprogrammen verbunden. Die Prägung durch eine Dritte-Welt-Ideologie ist stark und in den siebziger Jahren geprägt durch : „Ein Land hilft dem anderen“, das goldene Zeitalter der Nichtregierungsorganisationen und der internationalen Programme, die sich an diejenigen richten, die von der formalen Bildung ausgeschlossen sind, mit dem Ziel, eine universelle Grundschulbildung zu erreichen.
Die Besonderheit der Aktivitäten, die Merkmale des Zielpublikums, der innovative Charakter des Ansatzes, die Besonderheiten der Strategien, die Vielzahl der Akteure und die Flexibilität des Interventionsrahmens haben lange dazu beigetragen, die nicht-formale Bildung als „armer Verwandter“ der Erwachsenenbildung zu beschreiben und damit ihre Marginalisierung, ihren mangelnden Status und ihre mangelnde Anerkennung zu verstärken.
Doch während eine der Hauptaufgaben der formalen Bildung nach wie vor darin besteht, junge Menschen auf ein unabhängiges Leben in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht vorzubereiten und Ausgrenzung zu verhindern, verlieren die Schulen in dem Maße, in dem sich das Bildungssystem und der Arbeitsmarkt getrennt entwickeln, ihr Monopol auf das Lehren und Lernen. Nicht-formale Bildung scheint dann eine der Kräfte zu sein, die dieses Monopol herausfordern und alternative Möglichkeiten, Alternativen und Lernorte bieten. Als Referenzsystem für innovative Praktiken mit transversalen Kompetenzen in einem unmittelbaren Bildungsumfeld ist das vorgeschlagene Angebot so vielfältig wie die Empfänger, für die es bestimmt ist. Sie erleichtert somit das Erlernen von Kenntnissen und Kompetenzen, die schon anerkannt sind oder sich im Prozess der Anerkennung befinden. Tatsächlich ist die nicht-formale Bildung, die seit dem Memorandum über lebenslanges Lernen (2000) auf europäischer Ebene anerkannt ist, in aktuelle Bildungsfragen eingebunden.
Wenn man über informelle Bildung spricht, bedeutet das, vom Lernen zu sprechen. Die institutionelle Struktur rechtfertigt den Begriff nicht, aber es geht darum, außerhalb jeder Institution zu lernen, ja sogar um jede Absicht. Wir verwenden diese Terminologie aus der europäischen Bildungs- und Ausbildungspolitik für 2012: „Informelles Lernen entsteht aus den Aktivitäten des täglichen Lebens, die mit der Arbeit, der Familie oder der Freizeit zusammenhängen. Sie ist weder organisiert noch strukturiert (in Bezug auf Ziele, Zeit oder Ressourcen). Informelles Lernen geschieht auf der Seite des Lernenden meist unbeabsichtigt.“ Terminologie, die klar sein soll, ist schwer zu handhaben. Ein Konzept, das innerhalb des formalen, nicht-formalen und informellen Triptychons für das Nachdenken über Bildung, Ausbildung und lebenslanges Lernen verwendet wird, wobei die Konturen verschwommen bleiben, wenn es darum geht, sie zu trennen.
Informelle Bildung erscheint als eine Erweiterung des erworbenen Wissens. Die weit verbreitete Verwendung des Begriffs „informell“ im Bereich Bildung trägt zur Verwischung dessen bei, das, was mit diesem Begriff bezeichnet oder qualifiziert wird, der verschiedene Konnotationen hat, ob er nun geschätzt oder verunglimpft wird.
Die Hauptmerkmale der nicht-formalen Bildung lassen sich in Aktivitäten zusammenfassen:
- die entsprechend der Zielgruppe und deren Einschränkungen organisiert sind;
- strukturiert, andernfalls wären sie Teil der informellen Bildung, die nicht systematisiert oder sogar unbeabsichtigt ist;
- bestimmt für eine identifizierbare Zielgruppe (und deren Bedürfnisse und Erwartungen erfüllen);
- ausgerichtet auf eine bestimmte Reihe von Lernzielen (Input-Output;
- nicht institutionalisiert, weil sie außerhalb des etablierten Bildungssystems stattfinden und sich an Lernende richten, die nicht regelmäßig eingeschrieben sind.
- Hat das Thema der nicht-formalen und informellen Bildung in Ihrer Arbeit und Forschung, insbesondere im französischsprachigen Afrika und in Brasilien, eine besondere Resonanz?
Im französischsprachigen Afrika wurde die nicht-formale Bildung sehr schnell zu einem Bollwerk gegen die Fehlfunktion des vorherrschenden formalen Systems. Tatsächlich schließt das derzeitige System einen großen Teil der Bevölkerung im Schulalter aus und garantiert keinen gleichberechtigten Zugang. Die Berücksichtigung einer mehrsprachigen Umgebung ist beispielsweise eine der Errungenschaften der nicht-formalen Bildung. Dies hat zur Umsetzung einer Sprachpolitik geführt, welche die Sprache der Lernenden in den ersten Jahren der Schulbildung oder in Alphabetisierungsprogrammen für Erwachsene betont. Einige Länder wie Mali und Burkina Faso gehen sogar so weit, die nicht-formale Bildung zu institutionalisieren, indem sie spezielle Ministerien schaffen.
Traditionelle Gesellschaften haben formale Bildungssysteme, die in Frage gestellt werden sollten, ohne das Risiko eines komparativen Ansatzes einzugehen, sondern mit der Absicht, das Verhältnis zwischen Kultur und Kognition zu problematisieren.
Brasilien wehrt sich stark dagegen, dass der Staat seine Rolle als „Erzieher“ garantiert, zumal die aktuellen politischen Veränderungen den sozialen Fortschritt behindern und integrative Ansätze oder die Berücksichtigung von Minderheiten und ihren kulturellen Traditionen in den Hintergrund stellen. Forscher und Praktiker in diesem Bereich ziehen es vor, den Begriff „soziale Räume der menschlichen Bildung“ zu verwenden, um alternative Bildungsmaßnahmen als Ersatz für die vorherrschenden formalen Bildungssystem zu beschreiben. Diese Räume, die von einer Pädagogen-Community eingerichtet werden, antworten auf den Bedarf nach einer zweiten Chance für diejenigen, die die Sekundarschulbildung nicht abgeschlossen haben, oder nach Angeboten für außerschulische und gering qualifizierte Jugendliche und Erwachsene.
In Übereinstimmung mit dem Vermächtnis von Paulo Freire werden die Initiativen aus der Perspektive entwickelt, dass „menschliche Aktivitäten ist beabsichtigt und nicht von einem Projekt getrennt. Wissen heißt nicht einfach, sich an die Welt anzupassen. Es ist eine Voraussetzung für das Überleben des Menschen und der Arten.“ In unruhigen Zeiten trügen diese Vorrichtungen zur Ausübung der Staatsbürgerschaft bei als „das Bewusstsein für Rechte und Pflichten und die Ausübung der Demokratie.“ Neben den Schulen gibt es in Brasilien auch Nichtregierungsorganisationen, Kirchen, Gewerkschaften, Parteien, Medien, Nachbarschaftsverbände usw. In der nicht-formalen Bildung ist die Kategorie Raum ebenso wichtig wie die Kategorie Zeit, wie Gadotti betont. In der Tat ist die Zeit für das Lernen in der nicht-formalen Bildung flexibel und respektiert die Unterschiede und Fähigkeiten jedes Einzelnen.
- Und schließlich, was hat aus Ihrer Sicht die Frage der nicht-formalen und informellen Bildung mit der Erwachsenenbildung im Allgemeinen zu tun?
Als ein autonomes und alternatives System ist die nicht-formale Bildung neben der informellen Bildung dem Kern des Bestrebens der internationalen Gemeinschaft verpflichtet, eine universelle Schulbildung und lebenslange Bildung und Ausbildung zu erreichen.
Lindeman beschrieb die Erwachsenenbildung 1926 in einem Artikel zum ersten Mal als „kooperatives Abenteuer des informellen, nicht-autoritären Lernens, dessen Hauptzweck darin besteht, die Bedeutung der Erfahrung zu entdecken. “ Mit anderen Worten, die Besonderheit der Erwachsenenbildung ist die Verbindung mit dem Leben, wo Lernen durch Erfahrung geschieht. Auf diese Weise maximiert informelle Bildung in Verbindung mit einem partizipatorischen Ansatz die prägende Dimension der Aktivität. Die Grenzen der informellen Bildung sind durchlässig: soziale Interventionen, außerschulische Aktivitäten, Familien- und Gemeinschaftsbildung, IKT usw.
Erfahrung wird als eine prägende Ressource im Kontext des täglichen Lebens, der Arbeit und der Freizeit anerkannt, mit folgenden Merkmalen: Fehlende Lernabsicht und soziale Institutionalisierung; Konfrontation mit der Erfahrung anderer und dem Zwang der Realität; initiatorische Wege, freiwillige Teilnahme ohne Zwang oder Erwartung der Anerkennung und Validierung früheren Lernens. Dennoch findet zu diesem letzten Punkt ein Austausch statt, um den Wert dieser Errungenschaften und ihre Anerkennung zu erhöhen. Trotz der Empfehlung des Rates vom 20. Dezember 2012 über die Validierung von nicht-formalen und informellen Lernergebnissen scheinen die ersten Ergebnisse dieser Umsetzung und der Eigenverantwortung gemischt zu sein. Frankreich hat als Vorreiter die gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf VAE erweitert, aber die Ergebnisse garantieren keine wirklichen und schnellen Fortschritte bei der Anerkennung informeller und nicht-formaler Lernergebnisse.
Ich danke Ihnen für diesen Austausch und Ihren Beitrag.
Gasse, S. (2017). Education informelle. In A. Barthes, J.-M. Lange & N. Tutiaux-Guillon (Dir.). „Dictionnaire critique des enjeux et concepts des „Educations à“. Paris: L’Harmattan. S.385.
Gasse, S. (2017). Education Non formelle. In A. Barthes, J.-M. Lange & N. Tutiaux-Guillon (Dir.) „Dictionnaire critique des enjeux et concepts des „Educations à“. Paris: L’Harmattan. S.392.
Gasse S. (Juni 2014). „Education non formelle : contexte d’émergence, caractéristiques et territoires“. Revue Education permanente. Nr. 199-2014.
Kommentar
est-il-possible
- Anmelden oder Registrieren, um Kommentare verfassen zu können
From non-formal to formal education
- Anmelden oder Registrieren, um Kommentare verfassen zu können
From your experience
- Anmelden oder Registrieren, um Kommentare verfassen zu können
Sobre a coabitação de 3 sistemas
- Anmelden oder Registrieren, um Kommentare verfassen zu können


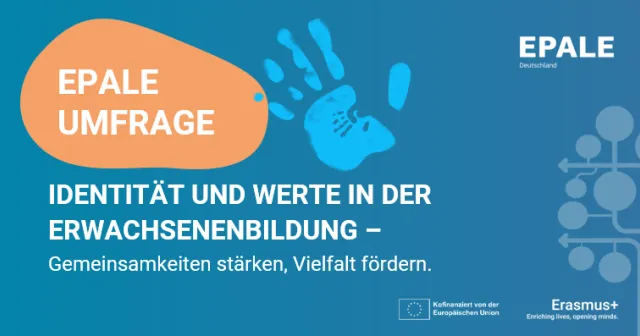


Education formelle, non formelle, informelle