Individuelle Lernkonten, um die Zugangsmöglichkeiten zur Erwachsenenbildung zu erhöhen

Der Beitrag wurde ursprünglich in englischer Sprache von Altheo VALENTINI veröffentlicht.
Am 4. und 5. März 2021 hat die Europäische Kommission mit der Veranstaltung des Hochrangigen Forums für Individuelle Lernkonten einen wichtigen Schritt in Richtung Umsetzung von Maßnahme 9 der Europäischen Kompetenzagenda unternommen, indem auf internationaler Ebene diskutiert wurde, wie mithilfe individueller Lernkonten bestehende Lücken beim Zugang zu Weiterbildung geschlossen werden können. Die Konferenz ist Teil einer größer angelegten Strategie zur Konsultation der Interessenträger*innen, im Zuge derer von März bis Juni 2021 auch eine öffentliche Konsultation erfolgen soll.
Dieses Forum erwies sich als hervorragende Möglichkeit, individuelle Lernkonten und verwandte Konzepte aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Einen Schwerpunkt bildeten dabei die gewonnenen Erkenntnisse, die in Forschungsarbeiten zu früheren und aktuellen Initiativen in der EU und im nichteuropäischen Ausland identifiziert und verglichen wurden. In der Eröffnungsansprache bezeichnete Nicolas Schmit, EU-Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte, individuelle Lernkonten als neuen Impuls für die Weiter- und Neuqualifizierung erwachsener Lernender, mit dem der gleichberechtigte Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung als Kernpriorität „unseres europäischen Sozialgefüges“ gefördert wird.
In der Charta der Grundrechte der Europäischen Union wurde bereits unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass jede Person das Recht auf Bildung sowie auf Zugang zur beruflichen Ausbildung und Weiterbildung hat. Folglich stellt das Recht auf Bildung in der aktuellen Veröffentlichung zur europäischen Säule sozialer Rechte nicht nur das Vorbild für den ersten Grundsatz „Allgemeine und berufliche Bildung und lebenslanges Lernen“ dar, sondern richtet sich auch an den vierten bzw. fünften Grundsatz, indem das Recht auf Weiterbildung und Neuqualifizierung zur aktiven Unterstützung der Beschäftigung und das Recht auf Weiterbildung ungeachtet der Art oder Dauer der Beschäftigung begründet wird.
Trotz einer generellen Berücksichtigung dieser Grundsätze müssen laut Kommissar Schmit in diesem Bereich nach wie vor Herausforderungen bewältigt werden. Aktuell nehmen jedes Jahr weniger als 40 % der Erwachsenen in der EU an einer Weiterbildung teil – gegenüber 50 % in den USA und Kanada. Als noch besorgniserregender erweist sich der Bereich der digitalen Kompetenzen, in dem nur die Hälfte der Europäer*innen über grundlegende Kompetenzen verfügt.
Mit den für 2030 angestrebten Kompetenzzielen vor Augen werden im Aktionsplan für die Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte Maßnahmen und Fortschrittsindikatoren festgelegt, um den Anteil der Erwachsenen, die jährlich an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen, auf 60 % und den Anteil der Erwachsenen mit grundlegenden digitalen Kompetenzen auf 80 % zu erhöhen. Die Erwachsenenbildung muss endlich das Stadium erreichen, in dem sie mit den anderen Bildungsniveaus verglichen werden kann. Sieht man sich die Geschwindigkeit an, mit der sich die Dinge heutzutage ändern, betrifft die Frage der Neuqualifizierung der Arbeitskräfte nicht nur das Hier und Jetzt. Es muss vielmehr auch in die Zukunft gedacht und es müssen Strategiepläne für die Weiterbildung erdacht werden, die Bildungs- und Arbeitsmarktstrategien miteinander vereinen. Um einen echten und nachhaltigen ökologischen und digitalen Wandel herbeizuführen, müssen die Menschen in den Mittelpunkt dieser öffentlichen und privaten Investitionsstrategien gestellt werden.
Kommissar Schmit befasste sich in seiner Ansprache ferner mit in die Zukunft gerichteten Fragen wie: Wer wird die Ausbildung eines immer größer werdenden Anteils an atypischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern fördern, die bestenfalls befristet beschäftigt sind? Wer wird diejenigen unterstützen, die eine Weiterbildung brauchen, um sich auf den Wechsel zu einem anderen Arbeitgeber vorzubereiten? Dies kann nicht den Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber*innen überlassen werden. Hier ist gemeinsames Handeln gefragt.
Die Europäische Kompetenzagenda, die im Juli 2020 vorgestellt wurde, beinhaltet 12 Maßnahmen, mit denen die Mitgliedstaaten umfassend unterstützt werden, damit das lebenslange Lernen Erwachsener Realität wird. Eine dieser Maßnahmen ist das Lernen von bewährten Verfahren zur erfolgreichen Umsetzung von individuellen Lernkonten, die den Hauptschwerpunkt des von der Kommission veranstalteten Hochrangigen Forums vom 4.-5. März darstellten.
Am ersten Tag dieses Forums wurde die Diskussion mit einem Vortrag von Élisabeth Borne, der französischen Ministerin für Arbeit, Beschäftigung und wirtschaftliche Inklusion, fortgesetzt, die der Frage nachging, „was individuelle Lernkonten in Frankreich bedeuten“. Obwohl in Frankreich 2014 der Anspruch des Einzelnen auf Weiterbildung anerkannt worden war, handelte es sich dabei um kaum mehr als einen theoretischen Anspruch. Erst durch die Schaffung der individuellen Lernkonten, die in Frankreich unter der Abkürzung CPF bekannt sind, im Jahr 2015 und deren Anpassung im Rahmen einer umfassenden Weiterbildungsreform im Jahr 2019 wird dieses Recht effektiv umgesetzt. Heute verfügen alle Arbeitnehmer*innen in Frankreich über individuelle Lernkonten, bei denen sie ihre individuellen „Ansprüche“ und die verfügbaren Dienstleistungen einsehen können. Diese „Ansprüche“ bestehen aus 500 Euro pro Jahr und bis zu 5000 Euro für Personen, die in Vollzeit arbeiten. Finanziert wird dieses Instrument über jährliche Beiträge von Unternehmen, wobei die Mittel nur mobilisiert werden, wenn eine entsprechende Weiterbildung stattfindet. Mithilfe dieser Mittel können Arbeitnehmer*innen die Kosten für Weiterbildungskurse aus einem einschlägigen Verzeichnis begleichen. „Mon Compte Formation“ (MCF, Mein Weiterbildungskonto) fungiert als Marktplatz, bei dem einschlägige Angebote und Gesuche zusammengebracht werden. Die Plattform wird von 20 000 Unternehmen genutzt, die über 300 000 verschiedene Weiterbildungskurse anbieten. Mit nur wenigen einfachen Klicks kann hier jeder eine Weiterbildung buchen.
Anschließend sprachen weitere Redner*innen zu verschiedenen Themen, bei denen es um Forschungsarbeiten zu individuellen Lernkonten und individuellen Lernprogrammen ging. Im Mittelpunkt standen die Erfahrungen von internationalen Organisationen, die über konkrete Ansätze verfügen, um diesem Anspruch auch nachzukommen. Dazu gehörten Vorträge zu folgenden Themen:
- „Die Menschenrechtsperspektive und der Zusammenhang zwischen individuellen Lernkonten und Nachhaltigkeitszielen“ von Borhene Chakroun, Direktor für Politik und Systeme des lebenslangen Lernens der UNESCO, der über „den Anspruch auf lebenslanges Lernen“ sprach und Anspruch definierte „als Garantie auf Zugang zu Leistungen auf der Basis von etablierten Rechten oder amtlicher Meldung“.
- „Individuelle Lernsysteme“ von Stefano Scarpetta, Direktor für Beschäftigung, Arbeit und Soziales der OECD. Er benannte drei verschiedene Systeme individueller Lernkonten:
1) Persönliche Sparkonten für die Weiterbildung (Individual Saving Accounts for Training, ISAT), wie es sie vor allem in Schweden, Kanada und den USA gibt, bei denen man Gelder für die Weiterbildung ansparen kann;
2) Individuelle Lernkonten wie in Frankreich und Singapur, bei denen über einen bestimmten Zeitraum Ansprüche auf Weiterbildung entstehen und die Mittel dafür nur mobilisiert werden, wenn tatsächlich an einer Weiterbildung teilgenommen wird;
3) Gutscheinregelungen, bei denen die Weiterbildung direkt über staatliche Zahlungen an den Einzelnen gefördert wird.
Es wurden noch viele weitere Beispiele und Beiträge vorgestellt, die nun auf der Website der Veranstaltung [EN] abrufbar sind. Die Konferenzteilnehmer*innen und Fachkräfte aus der ganzen Welt sind eingeladen, sich über die Accounts bei Facebook und Twitter von Social Europe über die neuesten Entwicklungen zu informieren und diese und künftige Veranstaltungen Revue passieren zu lassen bzw. sich an einschlägigen Diskussionen zu beteiligen.



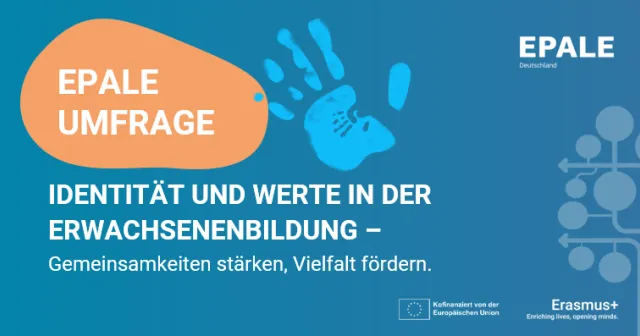


Merci
Merci pour cet article.