Heute bin ich mal resilient! Ein Modewort, über das es viel zu lernen gibt
Wer die Corona-Krise tapfer aushält, den Laptop am Küchentisch aufklappt und Onlinemmeetings mit der Firma trotz Kindergeschrei formvollendet meistert – ist resilient? Wer sich dem Bossmobbing beugt, ständige Ablehnungen bei Bewerbungen oder Misserfolgen bei Prüfungen über sich ergehen lässt oder verheerende gesellschaftliche Zustände aushält? Land auf Land ab versprechen Kurse, die Resilienz zu verbessern und so auch besser durch die Pandemie zu kommen.
Vergolde deine Narben – deine Stehaufmännchen-Kraft
Die VHS Hamburg bietet zum Beispiel einen Resilienz-Kurs an, der eine „Lebenskunst als eine Art Bewertungsstil“ vermittelt: „Wie Sie Ihre Narben vergolden können, erforschen wir gemeinsam an diesem Wochenende“, und zwar mit Alexander-Technik, Kommunikation und Meditation. In der VHS Hildesheim kann man per „resilienz-förderliche Denkhaltungen die persönliche ´Stehaufmännchen´-Kraft´ trainieren“, während die VHS Ratingen gleich zur Sache kommt und den Umgang mit „Extremsituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen“ einübt.
Achtsamkeitstraining, gesunde Lebensführung, Bewegung, Ernährung oder Umgang mit Stress werden häufig unter dem Label der Resilienz geführt – ebenso wie das Programm „Sieben Säulen der Resilienz LOOVANZ“ (Lösungsorientiertes Verhalten, Optimismus, Opferrolle verlassen, Verantwortung übernehmen, Akzeptanz, Netzwerkorientierung, Zukunfts- und Zielorientierung).
Im weitesten Sinne ist auch lebenslanges Lernen eine Methode, sich selber besser vor negativen äußeren Einflüssen zu schützen, wie es gerade das europäische European Lifelong Learning Magazine ELM mit seiner Themenausgabe über Resilienz betont: Die Pandemie hat nicht nur vom Individuum viele Lernprozesse abverlangt, angefangen vom Umgang mit Zoom bis hin zur Selbstdisziplin, täglich im Homeoffice den Arbeitsalltag selbst zu strukturieren. Sie hat auch vom System der Erwachsenenbildung schlagartig neue Kompetenzen eingefordert: neue Themen, neue Lernmethoden, neue Techniken, neue Organisations- und Finanzierungsformen.
Das System der Erwachsenenbildung muss resilient sein – trotz Corona
Als Expertin in der Ausgabe kommt die deutsche EPALE-Koordinatorin Dr. Christine Bertram zu Wort: Vor allem die Umstellung des Systems der Erwachsenenbildung auf hybrides Lernen stellt eine besondere Herausforderung dar: "Dies ist jedoch schwieriger als erwartet", sagt sie. Durch die Finanzierungskrise infolge der Pandemie sind die Teilnehmendenbeiträge in Deutschland deutlich gestiegen, was wiederrum dazu führe, dass Benachteiligte noch mehr von der Erwachsenenbildung ausgeschlossen werden. Auch die Lehrkräfte in der Erwachsenenbildung waren davon negativ betroffen. "Diejenigen, die sich schon vor der Pandemie in einer prekären Lage befanden, gerieten in eine noch ernstere Situation. Das gilt vor allem für viele Einzeltrainer - Menschen mit Null-Stunden-Verträgen, die in die Pleite gegangen sind und denen der Staat nicht immer helfen konnte", erklärt Dr. Bertram. Nun sei es wichtig, in dieser Veränderung die Erwachsenenbildung zu stärken: "Resilienz bedeutet also, diesen Übergang zu bewältigen, ohne die Menschen zurückzulassen."
Resilienz zeichnet demnach die Qualität des Bodens aus, aus dem heraus ein Mensch, eine Gemeinschaft, ein System oder ein Staat gedeihen kann. Man kann den Boden pflegen und stabilisieren, dann ist er auch gehaltvoll und fest. Vernachlässigt man ihn, halten die Wurzeln nicht mehr richtig.
Lesen Sie auch:
LifeComp: Kompetenzen für das Leben und Lernen in Zeiten des Wandels - von Dörte Stahl
Soft Skills Inventory: Einordnung eines Ansatzes in die Debatte über Life Skills - von Heike Kölln-Prisner
Positive Wirkungen von Trainings im beruflichen Kontext und mit sozialer Unterstützung – keine Effekte mit Achtsamkeitsübungen
Haben Trainings, die sich mit der Verbesserung der Resilienz beschäftigen einen Effekt? Dieser Frage ist eine Meta-Analyse von 197 Studien nachgegangen (Liu et al. 2020). Bei einigen Methoden, Zielgruppen und Anwendungsumständen zeigen die Studien eine Resilienz-Stärkung nach dem Besuch eines Trainings. Im beruflichen Kontext gibt es etwa einen positiven Effekt, oder wenn kognitive und kreative (z.B. Musik) Methoden sowie Maßnahmen, die auf soziale Unterstützung beruhen, zum Einsatz kommen. Keine Wirkung konnten die Forscher bei den untersuchten Studien bei Angeboten rund um das Thema Achtsamkeit feststellen.
Allerdings wird auch deutlich, dass es keinen Konsens darüber gibt, wie sich der Begriff der Resilienz operationalisieren lässt.
Erhöhung der Lebensqualität bei Demenz
Solche Maßnahmen – oder Interventionen, die auch als persönliche Therapie ablaufen könnten – sind einer aktuellen Untersuchung zufolge auch wirksam, wenn es darum geht, die Lebensqualität von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen wie Demenz oder Alzheimer zu verbessern. Resilienz-Interventionen schützen bei dieser Zielgruppe dagegen nicht eindeutig gegen Depressionen und neuropsychiatrische Verhaltenssymptome (Wang et al. 2021).
Resilienz beim Lernen? Lernen aus Misserfolgen?
Unter dem Aspekt des Lernens ist wesentlich, ob ein Mensch auch resistent gegen Lern-Misserfolge ist – die beim Lernprozess eigentlich dazu gehören. Man lernt ja schließlich aus Fehlern. Eine aktuelle Studie aus Chicago lässt einen anderen Schluss zu: Demnach verursachen Fehler negative Gefühle. Die Lernenden in der Studie, die Fehler machten, erbrachten schlechtere Leistungen und der Misserfolg hemmte das Lernen. Positiv wirkte sich dagegen aus, wenn richtige Antworten gegeben wurden. Wenn Misserfolg drohte, dann waren die Probanden auch nicht mehr für Informationen zugänglich: "Da Menschen ein Scheitern als bedrohlich für ihr Ego empfinden, schalten sie ab, d. h. sie hören auf zuzuhören. Ein solches Abschalten hat direkte Konsequenzen für das Lernen, denn Menschen können keine Informationen lernen, denen sie keine Aufmerksamkeit geschenkt haben." (Eskreis-Winkler/Fishbach 2019)
In der psychologischen Resilienzforschung hat man vor allem Menschen in den Blick genommen, die schwere Unglücke oder Katastrophen überlebt haben, und welche Eigenschaften dazu führen, dass die einen daran zerbrechen und andere nicht. Optimismus, Humor und Zuversicht oder eine funktionierende Gemeinschaft werden da häufig genannt. Allerdings sind Menschen viel zu unterschiedlich und komplex, als dass es simple Erklärungsmuster geben könnte (siehe Schnabel 2015).
Ist das Individuum allein verantwortlich?
Ohne Widerspruch bleibt das Konzept der Resilienz aber nicht. Vorgeworfen wird, dass negative Verhältnisse und Krisen quasi als gegeben vorausgesetzt werden, und vom Menschen ein Mechanismus verlangt wird, sich dagegen zu schützen. Wer von Hate Speech betroffen ist, soll sich also Resilienz antrainieren, statt zu lernen, gezielt gegen die Hater und ihre Medien vorzugehen. Dem Individuum wird ganz im neoliberalem Sinn die Verantwortung übertragen. Das gilt etwa für die Entwicklungshilfe: Menschen werden nach dem Prinzip der Selbsthilfe trainiert, resilient zu werden, statt sie durch Bildung zu befähigt, ihre zerstörerischen Bedingungen zu verändern und über Alternativen nachzudenken (siehe vor allem dazu das Buch medico international 2017).
Was man wohl sicher sagen kann: Schaden tut es nicht, sich mit seiner Widerstandsfähigkeit zu beschäftigen und sich zu bemühen, die Standhaftigkeit seines sozialen Umfeldes und der politischen Gemeinschaft zu stärken. Das schließt ja nicht aus, dass man sich auch für Veränderung und Wandel einsetzen kann – auf dem Boden einer resilienten und starken Persönlichkeit.
Weiterführende Literatur und Links
Eskreis-Winkler, Lauren/Fishbach, Ayelet (2019): Not Learning From Failure—the Greatest Failure of All. Psychological Science, 30. https://doi.org/10.1177/0956797619881133
Liu, Jenny J.W./ Ein, Natalie/ Gervasio, Julia/ Battaion, Mira/ Reed, Maureen: Comprehensive meta-analysis of resilience interventions. In: Clinical Psychology Review. Band 82, Dezember 2020, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272735820301070
medico international (Hg.) (20217): Fit für die Katastrophe? Kritische Anmerkungen zum Resilienzdiskurs im aktuellen Krisenmanagement. Gießen
Pasino, Sara: Can non-formal education be the future of lifelong learning? European Lifelong Learning Magazine 4 / 2021 (Theme issue redefining resilience) https://elmmagazine.eu/redefining-resilience/can-non-formal-education-be-the-future-of-lifelong-learning
Schnabel, Ulrich: Resilienz. Die Kraft aus der Krise. In: DIE ZEIT Nr. 45/2015
Wang, Ying/Chi, Iris/Zhan Yuning/Chen, Wenjang/Li, Tongtong (2021): Effectiveness of Resilience Interventions on Psychosocial Outcomes for Persons With Neurocognitive Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis. Front. Psychiatry 12:709860. doi: 10.3389/fpsyt.2021.709860, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2021.709860/full#h12


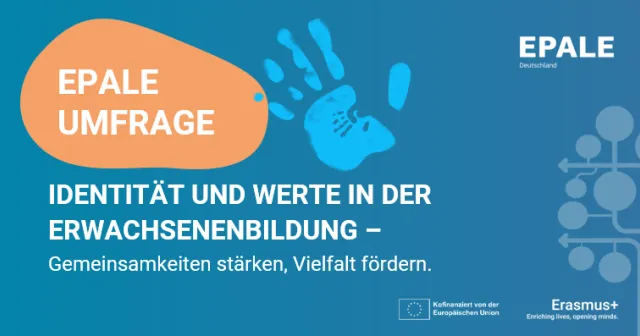


Resilienz als Privileg
Danke Michael, für diesen interessanten Beitrag. Dazu passt das Interview mit Sean Michael Morrisdes "Where is the human element in digital learning?" im ELM-Magazin. Er beschreibt, warum Resilienz (nicht selten) ein Privileg ist: "You cannot ask resilience from people lacking basic security in their life. ... For one, this means acknowledging that resilience is, in many ways, a privilege."
https://elmmagazine.eu/redefining-resilience/where-is-the-human-element-in-digital-learning/
Aber das Interview kennst du als Redakteur des ELM-Magazins natürlich :-)