Was ist Demokratiebildung?
Lesedauer ca. 4 Minuten - Lesen, liken, kommentieren!
Der Originalbeitrag ist im Journal für politische Bildung in der Ausgabe 01/2023 erschienen.
Dem Konzept der Demokratiebildung liegt ein sozialpädagogisches Verständnis zugrunde, wonach Demokratie in der Einheit von Demokratie leben und Demokratie lernen erfolgen muss. Auf der Basis eines deliberativen Demokratie- und radikalen Mündigkeitsverständnisses zielt Demokratiebildung entsprechend darauf ab, die demokratische Strukturierung gesellschaftlicher Institutionen zu motivieren und dadurch nachhaltige Perspektiven der Bildung in und zur Demokratie zu eröffnen.
Demokratiebildung ist ein aus der Sozialpädagogik stammendes Konzept, das sich als politische Bildung in und zur Demokratie versteht. Unter Rückgriff auf Jürgen Habermas‘ Theorie der Universalpragmatik zielt der Ansatz darauf ab, eine kommunikative Praxis der Konfliktaushandlung zu eröffnen, die es jeder von einer Entscheidung betroffenen Person gleichberechtigt ermöglicht, ihre kommunikativen Geltungsansprüche auf Wahrheit, Richtigkeit und Wahrhaftigkeit zu erheben, zur diskursiven Aushandlung zu bringen und in gemeinsame Entscheidungen auf demokratischer Grundlage zu überführen (Habermas 1981). Eine Beschränkung der demokratischen Teilnahme aufgrund von Alter, Reife oder Qualifikation (wie in Konzepten der Demokratiepädagogik, Politischen Bildung, Menschenrechtsbildung) bzw. eine Begrenzung auf bestimmte Zielgruppen (wie im Ansatz der Demokratieförderung) ist prinzipiell ausgeschlossen. Demokratiebildung richtet sich vielmehr an alle Menschen ab Geburt, weil Verständigung sprachpragmatisch gesehen universellen Kommunikationsstrukturen folgt, die sogar auch für (noch) nicht der Verbalisierung mächtige Personen gelten. Demokratiebildungsprozesse finden daher grundsätzlich in Mündigkeit zur Mündigkeit statt und haben als einzige Voraussetzung die der Betroffenheit von Entscheidungen.
Zentral für Demokratiebildung ist die von John Dewey und Jane Addams bereits vor rund 100 Jahren eingeführte Auffassung, wonach Demokratie nicht nur als Regierungsform, d.h. als z.B. repräsentative Demokratie, sondern auch und gerade als Lebensform zu realisieren sei. Auf dieser Grundlage zielt Demokratiebildung darauf ab, zur Demokratisierung aller gesellschaftlicher Institutionen beizutragen, Demokratie durch die demokratische Ausgestaltung von Interaktionen alltäglich erfahrbar werden zu lassen und so eine Einheit von Demokratie leben und Demokratie lernen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene umzusetzen. Der Begriff der Partizipation konkretisiert sich im Kontext von Demokratiebildung als eine von allen möglichen Betroffenen initiierte und praktizierte demokratische Partizipation. Sie berechtigt die Beteiligten, an allen Angelegenheiten mitzuentscheiden, von denen sie im Alltag betroffen sind, und ermöglicht ihnen damit, sich nicht nur als Adressat*innen, sondern zugleich als Urheber*innen an der Festlegung von Regeln und Normen zu beteiligen.
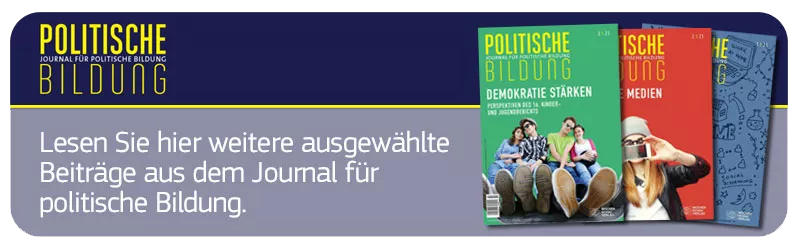
IDEAL EINER POLITISCHEN PARTIZIPATION
Jürgen Habermas hat dieses Ideal einer politischen Partizipation auf dem Hintergrund seiner Theorie der Gesellschaft in der Einheit von System und Lebenswelt zur Grundlage des Modells einer deliberativen Demokratie gemacht. Deliberative Prozesse lassen sich nach Habermas – anders als von Dewey angenommen – nicht in allen Sphären der Gesellschaft verwirklichen, weil die Voraussetzungen für Demokratie – also eine Herrschaft (kratia) des Volkes (demos) – nicht gleichermaßen gegeben sind. So ist er der Auffassung, dass in modernen Gesellschaften demokratische Partizipation vornehmlich in den zivilgesellschaftlichen Sphären der Lebenswelt umgesetzt werden kann, weil anders als in den systemischen Bereichen von Markt und Verwaltung der Vergesellschaftungsprozess in der Lebenswelt darin bestehe, wertrationale Ziele des solidarischen Handelns durch verständigungsorientiertes und damit deliberativ- demokratisches Handeln zu verfolgen.
Mit seiner Theorie der Pädagogik des Sozialen schließt Helmut Richter (2019) an die Überlegungen von Habermas an und formuliert Bedingungen für zivilgesellschaftliche Institutionen der Lebenswelt, die sich für deliberative Demokratie und Demokratiebildung auszeichnen. Besonders geeignet erscheinen danach Einrichtungen, die entsprechend dem Vereinsprinzip folgende Kennzeichen aufweisen: lokale Organisationsformen, freiwillige Mitgliedschaft, Selbstverwaltung durch wechselseitig ausgeübtes ehrenamtliches Engagement und Öffentlichkeit. Sie ermöglichen egalitär-diskursive Interaktionsformen (informelle Konsensdemokratie) sowie kodifizierte Formen der demokratischen Mitbestimmung (formelle und non-formelle Mehrheitsdemokratie) in Verbindung mit der Herstellung von Öffentlichkeit bei der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung (Richter et al. 2016).
Die theoretischen Grundlagen der Demokratiebildung wurden bereits seit den 1980er Jahren insbesondere in Bezug auf die demokratische Praxis von Gemeinwesen- und Jugendverbandsarbeit als Kommunal- und Vereinspädagogik entfaltet (Richter 2001). Daran anknüpfend sind eine ganze Reihe von konzeptionellen Differenzierungen und empirischen Überprüfungen von Demokratiebildung in sozialpädagogischen Organisationen entwickelt worden. Dazu gehören z.B. Forschungen zur Jugendverbandsarbeit (Riekmann 2011, Ahlrichs 2019, Ahlrichs/Fritz 2019), zur Ganztagsbildung (Coelen 2002, Maykus 2021) sowie zur Demokratiepraxis in der Kita (Richter/ Lehmann/Sturzenhecker 2017), der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (Sturzenhecker 2010, Schwerthelm 2022) und der Jugendsozialarbeit (Sturzenhecker 2022).
EINHEIT VON DEMOKRATIE LEBEN UND DEMOKRATIE LERNEN
Im Zentrum dieses Ansatzes von Demokratiebildung steht der Anspruch, die realen lebensweltlich-institutionellen Bedingungen der deliberativen Demokratie(-bildung) in ihren derzeitigen Möglichkeiten und Grenzen zu erfassen und auf dem Wege partizipativer Interaktions- und wechselseitiger Bildungsprozesse gemeinsam mit allen Betroffenen in der Perspektive eines Mehr an lebensweltlicher Demokratie zu entfalten.
Über die Autorin
Prof. Dr. phil. Elisabeth Richter lehrt Interkulturelle Soziale Arbeit an der MSH Medical School Hamburg. Sie forscht u. a. zu interkultureller Identitätsbildung, Demokratiebildung in Kitas und Jugendarbeit, gruppen- und gemeinwesenbezogenen Methoden der Sozialen Arbeit.
Literatur
Ahlrichs, Rolf (2019): Demokratiebildung im Jugendverband. Grundlagen – empirische Befunde – Entwicklungsperspektiven. Weinheim.
Ahlrichs, Rolf/Fritz, Fabian (2019): Demokratiebildung in antidemokratischen Zeiten. Der Beitrag der Vereine zur Sicherung der Demokratie – zwei empirische Einblicke aus Europa. In: Der Pädagogische Blick, Heft 2/2019, S. 39–48.
Coelen, Thomas (2002): Kommunale Jugendbildung. Raumbezogene Identitätsbildung zwischen Schule und Jugendarbeit. Frankfurt/M. u.a.
Habermas, Jürgen (1981): Theorie des kommunikativen Handelns. 2. Bde. Frankfurt/M. Maykus, Stephan (2021): Sozialpädagogik als Kooperation. Schule, Bildung, Netzwerke. Partizipation – ein Weg zur pädagogischen Kommunalentwicklung. Weinheim u.a.
Richter, Helmut (2001): Kommunalpädagogik. Studien zur interkulturellen Bildung. Frankfurt/M u.a.
Richter, Helmut (2019): Sozialpädagogik – Pädagogik des Sozialen. Grundlegungen, Institutionen und Perspektiven der Jugendbildung. 2., bearb. Aufl. Wiesbaden.
Richter, Elisabeth/Richter, Helmut/Sturzenhecker, Benedikt/Lehmann, Teresa/Schwerthelm, Moritz (2016): Bildung zur Demokratie. Operationalisierung des Demokratiebegriffs für pädagogische Institutionen. In: Knauer, Raingard/Sturzenhecker, Benedikt (Hg.): Demokratische Partizipation von Kindern. Weinheim u. a., S. 106–129.
Richter, Elisabeth/Lehmann, Teresa/Sturzenhecker, Benedikt (2017): So machen Kitas Demokratiebildung. Empirische Erkenntnisse zur Umsetzung des Konzepts „Die Kinderstube der Demokratie“. Weinheim u.a.
Riekmann, Wibke (2011): Demokratie und Verein. Potenziale demokratischer Bildung in der Jugendarbeit. Wiesbaden.
Schwerthelm, Moritz (2020): Partizipation in der Offenen Jugendarbeit in Luxemburg – Methoden und Qualitätsstandards. Luxembourg.
Sturzenhecker, Benedikt (2010): Demokratiebildung – Auftrag und Realität in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. In: Schmidt, Holger (Hg.): Empirie der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Wiesbaden, S. 131–146.
Sturzenhecker, Benedikt (2022): Demokratiebildung in der Jugendsozialarbeit – Das Konzept der GEBe-Methode zur Förderung gesellschaftlich- demokratischen Engagements von benachteiligten Jugendlichen. In: Landesjugendamt Westfalen Lippe (Hrsg.): Demokratiebildung in der Jugendsozialarbeit. Münster. S. 8–24.




