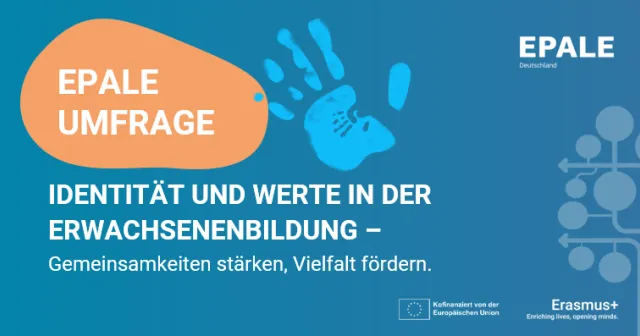Aktive Beteiligung begleiteter Personen: Worum geht es dabei?

[Übersetzung : EPALE Frankreich]
Junge Menschen begleiten und allen eine aktive Beteiligung ermöglichen
2. Artikel : Aktive Beteiligung begleiteter Personen: Worum geht es dabei?
Wie im vorherigen Blogbeitrag erwähnt, heißt es in den europäischen Prioritäten des Erasmus-Programms: „Europa muss sich auf die Vision und die aktive Beteiligung aller jungen Menschen stützen, um eine bessere, grünere, integrativere und digitale Zukunft zu schaffen.“ Darüber hinaus besteht im Rahmen des Europäischen Jahres der Jugend eine der vier Prioritäten darin, alle jungen Menschen, insbesondere die mit den geringsten Möglichkeiten, zu ermutigen, aktive und engagierte Bürger und Akteure des Wandels zu werden.
Während diese lobenswerten Absichten kaum Anlass zur Diskussion geben, stehen jedoch die Art und Weise, wie sie in der öffentlichen Eingliederungspolitik umgesetzt werden, zur Diskussion. Denn bei diesen konsensfähigen und unscharfen Absichtserklärungen stellt sich besonders die Frage nach der Umsetzung, die möglichst nah an den Akteuren und den Regionen erfolgen sollte. In diesem Artikel möchten wir klären, worum es bei aktiver Beteiligung geht und welche Ungenauigkeiten und Paradoxien dabei bestehen. Wir werden auch versuchen zu veranschaulichen, wie diese Absichten in der Praxis operationalisiert werden können, übrigens unabhängig von der betroffenen Zielgruppe.
Aktive Beteiligung und Misstrauen
Denn auch wenn sich die Frage nach der aktiven Beteiligung der Jugendlichen stellt, wird heute weithin die Frage nach Begleitdiensten gestellt, bei denen die Personen eine aktive Rolle spielen (als Akteure und nicht nur dem Urteil eines Experten unterworfen). Zweifellos, weil das Misstrauen gegenüber jeder Form von Expertise überall präsent ist. France Stratégie hatte dem Thema 2018 einen aufschlussreichen Bericht mit dem Titel „Expertise et démocratie: faire avec la défiance”gewidmet. Dieses Misstrauen wurde während des Covid-Zeitraums noch stärker, als das Thema Impfen in der Gesellschaft eine heftige Debatte über den Stellenwert von Expertenwissen, dessen Grundlage und die Wahlfreiheit jedes Einzelnen auslösten. Zweifelsohne hat die öffentliche Politik zwar den Diskurs über die Rolle der Menschen allmählich verändert (siehe den Titel des Gesetzes: Freiheit, seine berufliche Zukunft zu wählen), aber die Realität der Maßnahmen zeigt, von wenigen Ausnahmen abgesehen, ein Fortbestehen einer vertikalen, mehr oder weniger vorschreibenden Logik, in der die Wünsche der Menschen (ihre Prioritäten) und die Absichten der öffentlichen Politik im Hinblick auf die wirtschaftliche Anpassung (Besetzung der angespannten Sektoren) manchmal heftig gegeneinander stehen. Wie ein junger Kollege, der als Betreuer tätig war, erwähnte, ist der Entscheidungsspielraum einer Person umso geringer, je komplexer ihre persönlichen Umstände sind. Eine beschränkte Wahlfreiheit, die wenig in Richtung eines beteiligten Akteurs geht. Und auf jeden Fall nicht für alle. Im März 2022 veröffentlichte die Zeitung Le Monde Berichte von Jugendlichen, die diese mit Misstrauen gepaarte Sorge bestätigten: „Ich habe Angst um meine Zukunft und um die Zukunft des Planeten.” Eine interviewte Person drückt es sehr treffend aus : „Wie oft habe ich gehört: „Sie sind jung, das geht vorbei”. Ich bin 26 Jahre alt und habe immer noch die Hoffnung, dass die Vision einer solidarischeren und umweltfreundlicheren Welt, die ich hatte, als ich 16 Jahre alt war, einmal Wirklichkeit wird. Ich denke, dass junge Menschen oft herablassend behandelt werden ... .” Eine ewige Debatte?
Beteiligte Akteure, Ko-Konstruktion: Worum geht es?
All dies ist Teil eines Verständnisses von Menschen, die befähigt (nach der Formel von Paul Ricoeur) und in der Lage sind, Entscheidungen zu Themen zu treffen, die sie betreffen. Dies steht im Gegensatz zu einer Vorstellung von einer Dienstleistung, die auf der Grundlage von Fachwissen erstellt wird und auf einem diagnostisch-verschreibenden Ansatz beruht, bei dem die Person informiert und sogar um ihre Meinung gebeten wird. Die Ähnlichkeit mit medizinischen Begriffen ist nicht zufällig. Die Welt des Gesundheitswesens ist ein Umfeld, in dem Patienten seit mehreren Jahrzehnten damit begonnen haben, sich selbst zu organisieren, damit ihr Erfahrungswissen bei der Behandlung ihrer Krankheit berücksichtigt wird. Überall auf der Welt entwickeln sich Initiativen, die in diese Richtung gehen: Kollektive, Krankenhaus durch Patienten, Patienten-Experten, Intervention in Instanzen...
Allerdings kann diese Fülle an Informationen wichtige Unterschiede verdecken, die es zu klären gilt. Es lassen sich mehrere Register unterscheiden, die oft miteinander verwechselt werden und nicht dasselbe Niveau an Beteiligung der begleiteten Personen darstellen.
- Im ersten Register wird die Meinung der Person zu einem Vorschlag eingeholt, den man ihr macht (z. B. eine Priorität zwischen mehreren möglichen Entscheidungen zu nennen): Man gibt ihr die Gelegenheit, eine Meinung zu äußern, die dann berücksichtigt wird oder nicht.
- Das zweite Register bezieht sich auf die aktive Beteiligung der Person an dem ihr vorgeschlagenen Programm: Die aktive Beteiligung an Aktivitäten ist dabei lediglich eine Mobilisierung innerhalb des Vorschlags. Es bedeutet nicht, dass die Person einen eigenen Beitrag leistet. Es kommt darauf an, welche Art von Aktivität vorgeschlagen wird.
- Die dritte Möglichkeit, die wir für die fruchtbarste halten, besteht darin, dass die Person einen Beitrag zum Aufbau der Dienstleistung leistet, z. B. indem sie Hypothesen über die Art und Weise der Dienstleistung aufstellt: In diesem Fall geht es darum, Vorschläge zu machen. Diese Praxis findet man in Laboren für soziale Innovationen, mal mehr mal weniger auf Beiträge ausgerichtet.
Diese drei Niveaus der Beteiligung werden oft miteinander verwechselt. Man sieht auch, dass das Engagement von Personen in einer Einrichtung, an der sie beteiligt sind, nicht von der gleichen Intensität ist. Sie können sich umso mehr einbringen, je mehr sie das Gefühl haben, etwas zu tun, ihre Hände im Spiel zu haben, Ideen in die Tat umzusetzen, aber vor allem, wenn man ihre Beiträge ernst nimmt.
Ambiguitäten und Paradoxien der öffentlichen Politik
Diese kooperativen Praktiken sind natürlich nicht neu, und alle Akteure der Volksbildung deklinieren sie seit Jahrzehnten im Alltag mit einer Vielzahl von Zielgruppen durch. In einigen Bereichen (z. B. in Unterkünften) wurde die Beteiligung der Zielgruppen vom Gesetzgeber eingeschränkt. Herausfordernd ist der Umstand, dass diese Praktiken, deren Relevanz heute weitgehend dokumentiert ist, tatsächlich den Aufbau von öffentlichen Programmen beeinflussen.
Diese Zweideutigkeit ist nicht erst seit heute bekannt, aber sie ist leichter zu erkennen. In Frankreich wird im Programm der 2. Runde des Projekts „Mobiliser les publics invisibles” (Mobilisierung der unsichtbaren Zielgruppen) vermerkt: „...setzt sich daher zum Ziel, einen anderen Ansatz zu fördern, der von den Menschen, den Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert sind, und den Projekten, die sie entwerfen, ausgeht, und nicht von Einrichtungen und Verwaltungslogiken. ”
Diese Aussage ist zwar zu begrüßen, doch in der Praxis sieht man eher die präskriptive Logik und die Mehrfachdiagnosen, die eher die Schwierigkeiten von Personen als deren Talente hervorheben. Finanzielle Zwänge, die Einteilung der Zielgruppen in Kategorien und die Betonung der Beeinflussung des Verhaltens von Personen im Hinblick auf vordefinierte sozioökonomische Auswirkungen (die berühmten Wachstumssektoren oder Spannungsfelder) sind immer noch die vorherrschende Regel. Alles in allem sind Wahlfreiheit und Respekt vor dem freien Willen sehr selektiv. Sie betreffen eher die Personen, die sich mit den System auskennen. Personen, die keine Erfahrung damit haben, befinden sich in einer Position eingeschränkter Wahlmöglichkeiten mit vorbestimmten Optionen. Kurz gesagt, verstärkt die Nichtinanspruchnahme von Rechten das allgemeine Misstrauen noch weiter.
Notwendige Illustrationen
Der Konsens über allgemeine Prinzipien (Individuum als Akteur, Haltung der Ko-Konstruktion) wird allerdings nicht immer in erkennbare Handlungen umgesetzt. Vielleicht liegt es auch daran, dass dieses Prinzip gerade unter diesem Allgemeinheitsgrad leidet und häufig nicht veranschaulicht wird. Ohne konkrete Beobachtungen, bei denen diese Prinzipien verbreitet und angenommen werden, kann es jedoch keine Ko-Konstruktion geben. Nehmen wir zwei Beispiele, die wir in einem späteren Blogbeitrag über Epale erläutern werden.
Berufliche Texte (z. B. die Aufstellung der Kompetenzbilanz). In Frankreich gibt es eine lange Tradition, dass Fachleute Texte über Personen verfassen, die unterschiedliche Ziele und Adressaten haben. Es gibt jedoch nach wie vor Ambiguitäten, die das Problem der Beteiligung verdeutlichen. Ist es der Experte, der ein Urteil über die Person und die zu verfolgende Strategie abgibt? Wenn Ja, dann übersetzt sich das in Befehls-Verben bzw. Formen des eindringlichen Rats: „ Sie müssen .... ” ist ein typisches Verb, das eine Empfehlung ausspricht. Wenn man davon ausgeht, dass die Begleitung ein Prozess der Ko-Konstruktion ist, bei dem der Standpunkt der Person im Mittelpunkt steht, dann wird die Formulierung in der schriftlichen Form sehr unterschiedlich sein und diese Kooperation zum Ausdruck bringen „Wir haben uns geeinigt” ist eine häufig anzutreffende Formulierung.
Die Lektüre solcher Texte zeigt eine Ambiguität, bei der die Person nicht immer die Möglichkeit hat, etwas beizutragen. Man kann sie natürlich um ihre Meinung bitten, aber das ist nicht das gleiche Beteiligungsniveau. Zu sagen, ob man mit dem Geschriebenen einverstanden ist oder nicht, ist nicht gleichbedeutend mit einem Beitrag zu den Schlüsselelementen eines Textes. Um bei der medizinischen Analogie zu bleiben: Das Einhalten des vom Facharzt ausgestellten Rezepts und ein Beitrag zur Festlegung der einzuleitenden Therapie sind nicht dasselbe.
Diese Herausforderungen finden sich auch in den vielfältigen Versuchen, Laboratorien für soziale Innovation von und mit jungen Menschen gemeinsam aufzubauen. Die Beteiligung der Öffentlichkeit setzt aber auch Modalitäten voraus, die den Gepflogenheiten junger Menschen entsprechen, schnell und nicht zu formell sind. Das Twitch-Teleprojekt Lab'On-Id, das vom lokalen Verein der Missions Locales de Provence Alpes Côte-d'Azur getragen wird, ist ein Laboratorium für die Meinungsäußerung junger Menschen, das verschiedene Modalitäten und Medien mobilisiert: mündliche Kommunikation (Gesprächsrunden, Austausch...), Video (Erfahrungsberichte), Radio, soziale Netzwerke, TV-Sendungen...
In diesem Bereich gibt es zwar überall in Europa eine Fülle von Initiativen, die aber nur Aussicht auf Erfolg haben, wenn diese Parole berücksichtigt wird und die betroffene Zielgruppe das Gefühl hat, Einfluss auf die sie betreffenden Entscheidungen nehmen zu können. Die Frage der Bürgerbeteiligung ist natürlich kein jugendspezifisches Thema. Hier wird deutlich, wie schwierig es ist, von einer bloßen Debatte und Sammlung von Standpunkten zu einer Veränderung der öffentlichen Politik zu gelangen.
Dieses Problem zeigt sich immer wieder. Beteiligung zu fördern bedeutet nicht nur, aktive und dynamische pädagogische Maßnahmen umzusetzen, mit denen Personen stimuliert werden. Es geht darum, ein anspruchsvolles Begleitungs-Engineering zu entwerfen, das versucht, Anordnungen von Maßnahmen zu schaffen, die auf bestimmten Prinzipien beruhen:
- Das Erfahrungswissen jeder Person aufwerten: Dies setzt voraus, dass die Begleitung nicht nur als Beziehungsunterstützung, als Raum für gemeinsame Überlegungen zu Zukunftsszenarien, sondern auch als Ort zum Schaffen neuer Erfahrungen und Gelegenheiten für Begegnungen gedacht wird.
- Aufbau auf den von der Zielgruppe bevorzugten Modalitäten: Es ist kaum möglich, weiterhin vertikale Modelle durchzusetzen, die auf mehr oder weniger flexiblen Vorgaben basieren.
- Klarstellen von Prinzipien in Systemen, die dazu neigen, Publikumsströme zu kategorisieren und zu normieren oder sogar zu quantifizieren.
Begleiten bedeutet, jeder Person in ihrer Einzigartigkeit zuzuhören und ihre Mobilisierung zu dem, was sie in ihrer Situation anspricht, zu fördern. Und dies lässt sich nicht auf die Fokussierung auf Kurven und Ströme reduzieren, die uns alle auf einen Satz von Daten reduzieren.
André Chauvet
https://www.strategie.gouv.fr/publications/expertise-democratie-faire-defiance