Zeitfenster für politische Bildung (er)öffnen
Lesedauer ca. 4 Minuten - lesen, linken, kommentieren!
Der Originalbeitrag ist ursprünglich im Journal für Politische Bildung in der Ausgabe 4/2024 erschienen.
Politische Bildung kann ihre Ziele nur erreichen, wenn Menschen sich Zeit nehmen und auf ihre Formate, Methoden und Inhalte einlassen. Mitunter wirken diese auf ihre Adressat*innen allerdings kompliziert und weit weg. Zudem fehlt es vielen Menschen – zumindest subjektiv – an Zeit. Ansätze der aufsuchenden Arbeit ermöglichen niedrigschwellige Zugänge, setzen aber auch den Mut politischer Bildner*innen voraus, in Angeboten wie dem vermeintlich „klassischen Infostand“ keine Banalität, sondern eine Chance zu sehen.
Seit ca. 1,5 Jahren ist das Gustav-Stresemann-Institut (GSI) mit einem Bildungs- und Informationsstand zu „Wirtschaftswissen akut“ in der Region unterwegs. Die Schwerpunkte der Aufsteller, Informationsmaterialien und interaktiven Elemente variiert: 2023 stand das Themenfeld Preisentwicklung/ Inflation im Mittelpunkt, 2024 die europäische Sozialpolitik. Der Stand kann mobil vor Ort schnell aufgebaut sowie durch Onlinematerialien ergänzt und ständig erweitert werden. Zudem ist er auf die örtlichen Begebenheiten anpassbar also modular veränderbar. So gestaltet sich die politische Bildungsarbeit auf Marktplätzen anders als am Rande einer Sozialkonferenz. Die Frage nach der Zeit spielt dabei eine Rolle.
Infostand und Informationsgespräche: Weniger ist manchmal mehr
Eine Zwischenauswertung der bisherigen Arbeit zeigt: Erreicht werden konnten viele Menschen. Manche nutzten das Angebot für kurze Informationsgespräche, andere für eine inten- sive Beschäftigung mit den Inhalten und Themen des Standes. Im Sinne der aufsuchenden Bildungsarbeit wurden die Standorte so gewählt, dass die Menschen von sich aus auf die Angebote aufmerksam wurden und den Stand aktiv aufsuchten. Wenn man der (scheinbaren und tatsächlichen) allgegenwertigen Politikskepsis Glauben schenken würde, müsste ein solcher Informationsstand über politische Themen eigentlich scheitern. Wer will schon am Marktstand, in der Fußgängerzone oder bei einem Fest auf offener Straße über Politik reden? Wer nimmt sich die Zeit für politische Diskussionen über „komplizierte“ Wirtschaftsfragen und die „trockene“ EU? Wer nutzt einen Teil seiner privaten Zeit für spontane Gespräche über die Mindestlohnharmonisierung?
WER NIMMT SICH ZEIT FÜR POLITISCHE DISKUSSIONEN ÜBER „KOMPLIZIERTE“ WIRTSCHAFTSFRAGEN?
Unsere Erfahrungen zeigen, dass diese Befürchtungen unbegründet waren. Die Menschen nahmen das Angebot sehr gut an. Sie kamen mitunter bereits an den Stand, ohne dass wir diesen richtig aufgebaut hatten, verbrachten Zeit an den Informationstafeln oder lasen sich die ausgelegten Informationsmaterialien durch. Deutlich wurde: Viele wollten über ihre eigenen Positionen diskutieren, ihrem Unmut Luft machen oder sich differenziert informieren. Zeitweise entstanden längere Gespräche und Diskussionen auch zwischen den Besucher*innen etwa zu den Themen Verfassungsfeindlichkeit der AfD oder nachhaltige Energie- und Mobilitätspolitik. Mitunter zeichnete sich so etwas wie „Peer to Peer learning“ ab: Freundinnen erklärten ihren Freundinnen die historische Inflation von 1933 oder Wirtschaftsstudierende Schüler*innen spontan den Mindestlohn. Der Wunsch sich Themen in der Gruppe zu nähern und den Stand für soziale Interkationen zu nutzen war groß und somit Motivator für gemeinsames Lernen.
Auch andere niedrigschwellige Elemente zeigten sich erfolgreich: Eine Europatafel lud dazu ein, sich spielerisch mit der Inflation bzw. dem gesetzlichen Mindestlohn in verschiedenen Ländern zu beschäftigen, indem man diese erraten musste. Dabei stellte sich heraus, dass Menschen, die zunächst skeptisch waren, die Aufgabe sehr gut lösen konnten. Intuitiv wurden sich so oftmals komplexe Zusammenhänge erschlossen. Dies weckte die Lust, mehr zu erfahren, da aus unserer Sicht Erfolgserlebnisse und Lernerfolge in kurzer Zeit direkt sichtbar und belohnt wurden.
Der Informations- und Bildungsstand konnte also eine zentrale Herausforderung der Bildungsarbeit plastisch beantworten: Wie schaffe ich es als politische*r Bilder*in im öffentlichen Raum Zeitfenster zu (er)öffnen, in denen sich Menschen mit Politik beschäftigen (wollen)? Wie öffnen sich Zeitfenster auch bei Menschen, die es entweder nicht gewohnt sind, sich mit politischen Fragestellungen zu beschäftigen oder dies, aus welchen Gründen auch immer, nicht regelmäßig tun? Der Schlüssel ist der offene und vielfältige Zugang bei einem Konzept der aufsuchenden Bildung.
WIE KÖNNEN IM ÖFFENTLICHEN RAUM ZEITFENSTER ERÖFFNET WERDEN, IN DENEN SICH MENSCHEN MIT POLITIK BESCHÄFTIGEN WOLLEN?
Direkte Ansprache als Zeitfensteröffner
Die Zugänge zum Informationsstand waren die eben beschriebenen Infotafeln und Flyer in vereinfachter Sprache, ausgewählte Materialien zur Vertiefung, das Quiz, ein Kreuzworträtsel oder das direkte Gespräch. Die direkte Ansprache (z. B. zur Teilnahme am Mindestlohn- oder Wahlbeteiligungsquiz) stellten sich dabei oft als Zeitfensteröffner dar. Natürlich gab es auch ablehnende Reaktionen, bis hin zu verbalen Entgleisungen. Die sehr große Mehrheit aber nahm sich die Zeit, über mindestens einen der angebotenen Wege in die Interkation zu kommen. Sie blieben an den plakativen Aufstellern stehen, reagierten auf die aktive Ansprache, lasen den Flyer oder fühlten sich von den Stellwänden mit Informationen und weiterführenden Beratungs- und Bildungsmöglichkeiten angesprochen. Vor allem die Verbindung von Alltagserleben (z. B.: Die Preise in den Geschäften sind hoch, die Löhne niedrig), dem thematischen Fokus des Standes (Preisentwicklung, Mindestlohn, Wahlentscheidung), dem Ort (Marktplatz, Fußgängerzone, Sozialkonferenz) und der Unparteilichkeit bot dabei ein hohes Maß an Ansprachepotential.
Der Zugang über QR-Codes und eine Sammlung von Materialien auf einer egleitinternetseite wurde dagegen nur begrenzt angenommen. Immer wieder wurde deutlich, dass sich Menschen (gleich welcher Herkunft, sozialen Lage oder Vorwissen) eher das persönliche Gespräch, die Begegnung und die verlässliche und überparteiliche Information direkt vor Ort wünschten. Sie verbringen zwar sehr viel Zeit „im Internet“, wollen dies dann aber nicht unbedingt vor Ort an einem Ort mit Dialogpotential tun.
Das Verweilen am Stand als niedrigschwellige Bildungsgelegenheit nutzen
Als besonders erfolgreich kann der Stand vor der Europawahl bewertet werden. Dabei hatten wir hier die Befürchtung, dass man mit den Parteien um die Aufmerksamkeit der Bürger*innen konkurrierte. Denn wer investiert Zeit, vermeintlich „alle“ Wahlstände abzugehen und dann noch zu einem weiteren? Doch auch hier zeigte sich, dass sich diese Befürchtungen nicht erfüllten. Die direkte Nähe zur Europawahl war eher förderlich. Der Stand wurde als parteipolitisch neutrale Instanz wahrgenommen. Die Unabhängigkeit von Information offensiv zu signalisieren, half dabei, die Wertigkeit, seine Zeit am Stand zu verbringen deutlich zu machen. Viele wurden so in ihrer Wahlabsicht bestärkt, andere konnten Informationen einholen, um eine fundierte Wahlentscheidung treffen zu können und wieder andere wurden das erste Mal über die Wahl informiert. So konnte der Stand möglicherweise einen (begrenzten) Beitrag zur Steigerung der Wahlbeteiligung leisten.
Die Motivation sich zu bilden, war vielfältig. Die weit überwiegende Mehrheit der Menschen, die an den Stand kamen, zeigten sich konstruktiv und offen für neue Informationen – manche sogar wissbegierig. Andere wiederum wollten ihre Meinung sagen oder suchten Gesprächspartner*innen für ihre individuelle Situation und Fragen. In manchen Fällen konnten wir auf Hilfssysteme verweisen oder weitere Ansprechpersonen vermitteln. Denn der Infostand ermöglichte den politischen Bildner*innen nur begrenzt Zeitressourcen für Einzelgespräche einzusetzen. Dennoch hatte der Stand wichtige Funktionen: Ansprechbar sein, Informationen und eine Breite an Positionen anzubieten und ein Begegnungsort für Menschen zu sein.
Abwägungsnotwendigkeiten zwischen „akzeptierender“ und werteorientierter Bildungsarbeit
Menschen so direkt und offensiv in ihrer privaten Zeit zu politischen Themen anzusprechen, birgt sicherlich Risiken und Konfliktpotential. Wir im Team haben allerdings immer wie- der reflektiert, wo die Grenze zwischen „akzeptierender“ und werteorientierter Bildungsarbeit verläuft, also wann man politische Diskussionen zulässt und wann man klar Position (z. B. für die Werte des Grundgesetztes) bezieht. Die didaktischen Hilfsmittel (u.a. der Amadeu-Antonio-Stiftung oder des AdB) sind zwar allen im Team bekannt, aber es entscheiden in der Bildungspraxis oft einzelne Wörter oder Details darüber, ob sich ein Gespräch noch „gerade so“ innerhalb oder schon außerhalb der demokratischen Grundwerte abspielt. Auch ganz praktische Fragen der Grenzziehung spielten in den Reflexionen eine Rolle: Wann setze ich als politische* r Bildner*in die begrenzte Zeit ein, um Einzelgespräche zu führen? Wann, um Menschen für spielerische Elemente anzusprechen? Wann musste ich Gespräche aus inhaltlichen oder zeitlichen Gründen beenden? Dabei bewährte sich der Ansatz erst einmal genau zuzuhören, die Überparteilichkeit zu betonen und gleichzeitig transparent zu machen, dass wir klar für Demokratie und Menschenrechte stehen. Im Einzelfall zeigte sich diese Grenzziehung allerdings schwierig: Was mache ich bei einer Diskussion darüber, dass die Erdachsenverschiebung an allen Wirtschaftsproblemen schuld sei? Wie reagiere ich auf emotionale Ablehnung des ganzen politischen Systems? Wie ordne ich offensichtliche Fake News ein? Wie reagiere ich auf eine Person, die auch nach dreißig Minuten weitere persönliche Erlebnisse loswerden will? In den Reflexionsrunden über diese Fallbeispiele konnten wir viel für unsere weitere Arbeit lernen. Hilfreich bei der weiteren Beschäftigung mit diesen Fragen sind beispielsweise die Materialien auf www.politischbilden.de.
Wie wir aus dem Demokratiebericht Nordrhein-Westfalen (Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen 2023, S.127 ff.) wissen, wünscht sich die überwiegende Mehrheit mehr Informationen über Politik. Dies können wir aus den Erfahrungen (nicht nur) dieses Projektes bestätigen. Viele Menschen gaben uns die Rückmeldung, dass sie sich in Schule, Betrieb oder in ihrer Freizeit zwar immer mal wieder mit Politik oder politischen Fragen konfrontiert sehen, sie aber weder die Zeit noch die Möglichkeit oder auch Kompetenz haben, sich differenziert (und verlässlich) zu informieren. So konnten ganz neue Teilnehmende für politische Bildungsveranstaltungen in einem formaleren Rahmen gewonnen werden.
ES FEHLT DEN MENSCHEN IM ALLTAG OFT AN ZEIT, SICH MIT POLITISCHEN THEMEN DIFFERENZIERT AUSEINANDERSETZEN ZU KÖNNEN.
Aus den bisherigen Erfahrungen lässt sich ein durchweg positives Fazit ziehen. Offene, niedrigschwellige Informations- und Bildungsstände zu konkreten und aktuellen politischen Themen sollte es flächendeckend geben – vor Ort und aufsuchend. Das kann als „Pop-Up-Stand“, als mobile Lastenradstation oder als umgestaltetes Ladenlokal sein. Einfache Sprache, differenzierte Zugänge und aktuelle (kontroverse) Themen, die direkt an der Lebenswirklichkeit andocken eignen sich besonders. Das Gustav Stresemann Institut e. V. ist ein unabhängiger Träger der politischen Bildung mit Sitz und eigener Tagungsstätte in Bonn. Das GSI ist anerkannter Bildungsträger der Bundeszentrale für Politische Bildung und des Landes NRW.
Die originale PDF-Datei des Artikels können Sie direkt unterhalb des Beitrages herunterladen
Über den Autor:
Daniel Weber leitet die Abteilung Politische Bildung im GSI nud verantwortet die Themenfelder Demokratie, Frieden und Nachhaltigkeit. Er ist Diplom Volkswirt, sozialwissenschaftliche Richtung mit Studium in Köln und Dublin und war viele Jahre in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit tätig.


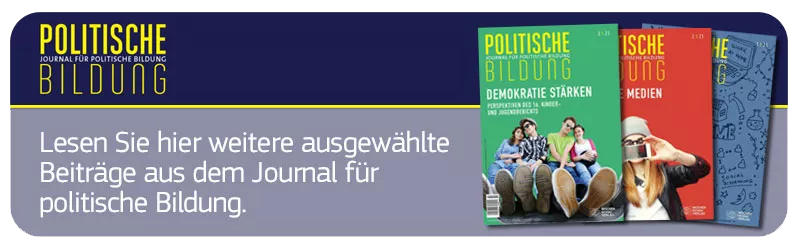



Großartige Inhalte, aber die Lesbarkeit ...
Die Inhalte des Journals für Politische Bildung sind großartig und es ist toll, dass wir sie auf EPALE lesen können.
Aber die Beiträge sind nur schwer lesbar. Insbesondere die Zeilenhöhe macht es schwer, die Arikel ohne Anstrengung für die Augen zu lesen. Es wäre sehr, sehr hilfreich, wenn die Beiträge so formatiert wären, wie andere EPALE Beiträge auch.
Ich würde mich freuen, wenn man diesen Vorschlag aufgreifen könnte. Denn inhaltlich sind die Beiträge - wie schon geschrieben - eine echte Bereicherung.