Politische Erwachsenenbildung in Österreich: Historische Entwicklungen und aktuelle Herausforderungen
Lesedauer ca. 3 Minuten - lesen, liken, kommentieren!

Sonja Luksik / Hakan Gürses
Die Geschichte der Politischen Bildung in Österreich ist geprägt von fehlender Anerkennung, geringen finanziellen Mitteln und mangelhafter Institutionalisierung. Zu Beginn der Zweiten Republik trug der Status Österreichs als „erstes Opfer des Nationalsozialismus“ maßgeblich dazu bei, dass „Re-Education“-Maßnahmen der Alliierten, die allmählich zur politischen Bildung als flächendeckendem Fach in und außerhalb der Schule führten, auf Deutschland beschränkt blieben. Der sogenannte Opfermythos förderte nach 1945 das Verständnis von politischer Bildung als traditionelle Heimat- und Staatsbürgerkunde.
In den 1970er-Jahren, somit in Zeiten des gesellschaftlichen Transformationsprozesses hierzulande, erhielt politische Bildung einen neuen Stellenwert und wurde zum Gegenstand (partei-)politischer Debatten. Im Kontext von zunehmenden Volksbegehren, Volksabstimmungen und Volksbefragungen erblickte die Politik darin zwar ein wichtiges Instrument für die Demokratisierung der Gesellschaft; politische Bildung rückte als dieses jedoch nicht in den Fokus öffentlicher Debatten.
Institutionalisierung und Diversifizierung
1977 wurde schließlich die bis dato einzige staatlich initiierte Fachorganisation für politische Bildung in Österreich gegründet: die Österreichische Gesellschaft für Politische Bildung (ÖGPB), die sich 1991 neu aufstellte und ihren Sitz nach Wien wechselte.
Heute gliedert sich die Arbeit der ÖGPB in zwei Geschäftsbereiche: „Projektförderung“ und „Bildungsangebote und Projektberatung“. Die Tätigkeiten der ÖGPB umfassen somit einerseits Projektmittelvergabe für politische Bildungs-Veranstaltungen in den Mitgliedsbundesländern, andererseits Planung, Konzeption und Durchführung von Weiterbildungsangeboten (Workshops, Trainings, Tagungen, Vorträge etc.) bundesweit in Kooperation mit Erwachsenenbildungs-Einrichtungen.
In den 1990er-Jahren entstanden auch Initiativen zur Professionalisierung der Erwachsenenbildung. Im selben Jahrzehnt kamen zudem vermehrt Initiativen der politischen Bildung in Vereinen und Selbstorganisationen (z. B. maiz – Autonomes Zentrum von & für Migrantinnen oder Frauenhetz – feministische Bildung, Kultur und Politik) auf, was zu einer Diversifizierung der politischen Erwachsenenbildung in Österreich beigetragen hat. In weiterer Folge wurde versucht, schulische politische Bildung zu stärken (z. B durch die Einrichtung einer „Schulservicestelle für Unterrichtsprojekte zur Politischen Bildung und Zeitgeschichte“, heute Zentrum polis).
Fehlende Anerkennung und Förderung
Zwei zentrale Herausforderungen für die politische Erwachsenenbildung in Österreich sind die fehlende öffentliche Anerkennung und die mangelnde finanzielle Förderung.
Nur ca. 10 Millionen Euro werden für die jährliche Förderung der Erwachsenenbildung (inklusive Budget für Büchereiwesen) durch öffentliche Hand bereitgestellt, ein Bruchteil davon fließt in die politische Erwachsenenbildung. Beispielsweise beträgt die jährliche Gesamtausschüttungssumme der ÖGPB für die Projektförderung etwas mehr als 300.000 Euro; auf Subventionen für Parteiakademien entfallen hingegen über 10 Millionen jährlich.
Was „darf“ politische Bildung?
Zu diesen österreichspezifischen Problemen kommen weitere Herausforderungen hinzu, die eher inhaltlicher Natur sind. Eine aktuelle Debatte in der politischen Bildung stellt, wiewohl eher in Deutschland als hierzulande geführt, jene um den Beutelsbacher Konsens dar. 1976 als „Minimalkonsens“ von Fachdidaktiker/innen auf einer Tagung im schwäbischen Beutelsbach beschlossen, gelten die drei Prinzipien dieses Leitbildes – Überwältigungsverbot, Kontroversitätsgebot und Teilnehmer/innenorientierung – heute als Richtlinien für die Praxis der politischen Bildung im deutschsprachigen Raum.
In aktuellen Fachdebatten gerät der Konsens jedoch zunehmend in die Kritik. Vor allem die Auslegung des Überwältigungsverbots wird derzeit heftig diskutiert. Viele Lehrende interpretieren diesen Grundsatz als „Neutralitätsgebot“ und glauben, sie müssten auf Äußerungen eigener politischer Meinungen und Standpunkte verzichten. Folgerichtig berief sich sogar die rechtspopulistische Partei Alternative für Deutschland (AfD) in ihrer Aktion „Neutrale Schulen Hamburg“ u. a. auf diese (Fehl-)Interpretation des Überwältigungsverbots und verlangte ein Ende des „AfD-Bashings“ in den Schulen. Es bleibt die Frage, ob politische Bildner/innen stärker Position beziehen sollen und ob der Beutelsbacher Konsens ihre Handlungsfähigkeit in der Lehrpraxis einschränkt.
Globaler Blick
Globale politische Entwicklungen bringen auch neue Herausforderungen für politische Bildner/innen mit sich. Aktuell lässt sich eine weltweite „autoritäre Wende“ beobachten. In Ungarn und Russland unterliegen Medien und NGOs staatlichen Kontrollen, in Ägypten und der Türkei werden Regierungskritiker/innen verfolgt, in „westlichen“ Demokratien wird die Forderung nach einer Stärkung der Exekutive und der nicht gewählten Expert/innen-Regierungen lauter. In Zeiten einer solchen Tendenz zum Autoritarismus und zur Abschaffung rechtsstaatlicher Strukturen ist die Darstellung politischer Systeme durch eine Gegenüberstellung von Demokratie und Diktatur unzureichend. Eine Herausforderung für politische Bildung ist es, Zwischenformen wie die „illiberale Demokratie“ verständlich zu machen.
In der politischen Bildung kann zudem eine „Demokratie-Verklärung“ konstatiert und kritisiert werden. Die Überhöhung der Demokratie als Wertekatalog, als Lebensweise, als höhere Form des menschlichen Zusammenlebens etc. ist problematisch und führt auch zu Enttäuschung von Erwartungen bzw. einer gewissen Verdrossenheit. Es ist wichtig, Demokratie bei all ihren Vorteilen als Herrschaftsform zu sehen, die von Anfang an auch hierarchische Elemente enthält.
Durch die Definition von Demokratie als Norm und Ziel der politischen Bildung ergibt sich außerdem eine „nationalstaatliche Formel“, die Demokratie mit Nationalstaat gleichsetzt. Eine weitere Herausforderung für politische Bildner/innen stellt daher die Überwindung des nationalstaatlichen Tellerrandes und die Erweiterung der eigenen Methoden und Inhalte um eine globale Perspektive dar.
Literatur:
Rahel Baumgartner & Hakan Gürses (Hrsg.) (2015): Im Blickwinkel: Politische Erwachsenenbildung in Österreich. Schwalbach/Ts.: Wochenschau Wissenschaft
Hakan Gürses (2016): Mühen der Ebene im Land der Berge. In: Klaus-Peter Hufer / Dirk Lange (Hrsg.): Handbuch politische Erwachsenenbildung. Schwalbach/Ts.: Wochenschau Verlag
Hans Knaller (Hrsg.) (1998): Gegenkonzepte. Politische Bildung und Erwachsenenbildung. Innsbruck/Wien: Studien Verlag
Autor/innen:
Sonja Luksik, MA: Studium der Politikwissenschaft an der Universität Wien und der Centré Européen Universitaire (CEU) in Nancy, Frankreich. Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Trainerin bei der Österreichischen Gesellschaft für Politische Bildung.
luksik@politischebildung.at
Hakan Gürses, Dr.: Jg. 1961, Studium der Philosophie in Wien. Wissenschaftlicher Leiter der Österreichischen Gesellschaft für Politische Bildung.
guerses@politischebildung.at
Lesen Sie auch die anderen Beiträge zum EPALE-Themenschwerpunkt:

|
Politische Bildung in Europa |
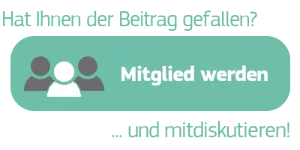


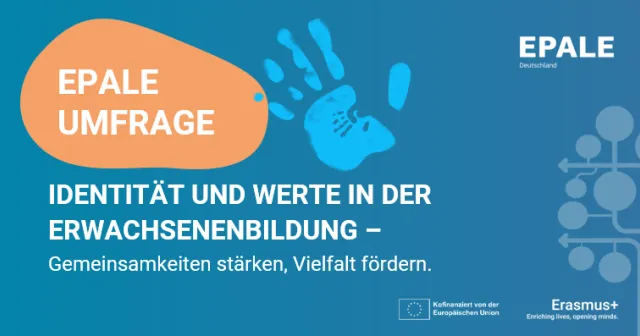


Politische Bildung sollte in